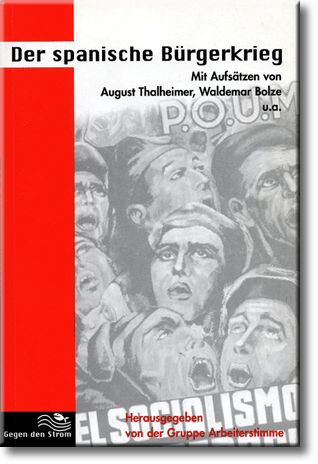Wenn man sich in der Welt umschaut, sieht man eine Reihe von Konflikten, bei denen es um die nationale Frage, um Forderungen nach nationaler Selbstbestimmung oder, pathetischer, nach nationaler Befreiung geht.
Katalonien, Kosovo, Kurdistan, Palästina, die Liste mit Beispielen ließe sich leicht verlängern. Die Ursache des Konfliktes ist meistens die Forderung einer Volksgruppe nach einer eigenen Staatlichkeit, gelegentlich auch nach einer weitgehenden Autonomie. Etliche der gegenwärtigen weltweiten Krisenherde beziehen ihren Sprengstoff aus ungelösten oder unterschiedlich aufgefassten nationalen Fragen.
Im folgenden sollen einige Überlegungen zu diesem Thema zur Diskussion gestellt werden: Was haben wir als Marxisten zur nationalen Frage zu sagen, nach welchen Kriterien beurteilen wir nationale Befreiungsbewegungen und welche Bedeutung haben diese unter den heute gegebenen weltpolitischen Bedingungen.
Ein kurzer Blick in die Geschichte
Die kommunistische/marxistische Bewegung begriff sich von Anfang an als internationalistisch. Nationalismus und nationalistische Bewegungen wurden kritisiert und man stand solchen Strömungen distanziert bis ablehnend gegenüber. Es gibt viele Äußerungen der Klassiker, die das belegen.
Die internationalistische Ausrichtung ist aber nicht die ganze Geschichte.
Bei der Analyse der dominierenden historischen Tendenzen im 19. Jahrhundert setzte sich der Gedanke durch, dass die Herausbildung der Nationalstaaten auch wesentlich von der Notwendigkeit bestimmt war, möglichst optimale Bedingungen für die Entwicklung der kapitalistischen Märkte zu schaffen. Eine Zusammenfassung aller Sprecher der gleichen Sprache in einem einheitlichen Staat sollte die Kommunikationsbedingungen verbessern und damit auch die Entwicklung der Märkte fördern. Eine ähnliche Funktion hatte die Überwindung der feudalen Zersplitterungen, etwa die Abschaffung der zahlreichen Binnenzölle oder die Ausbildung eines einheitlichen Rechtsraums. Solche Einschätzungen wurden z.B. von Karl Kautsky („Nationalität und Internationalität“, 1908) erarbeitet und galten damals als repräsentativ für den Marxismus. Sie wurden von Lenin und anderen Marxisten zustimmend aufgegriffen.
Die Nationalstaaten erhielten so den Status einer Zwischenstufe im Rahmen der „normalen“, erwarteten Entwicklung vom Feudalismus letztlich hin zum Sozialismus. Dazu passte auch, dass Länder, die eine größere Anzahl von Völkern in sich vereinten, wie etwa Österreich-Ungarn unter den Habsburgern, das zaristische Russland oder das türkisch-osmanische Reich hinsichtlich der Entwicklung des Kapitalismus rückständiger waren als die Nationalstaaten Westeuropas. Als Ursache dafür wurde das Fortbestehen mehr oder weniger bedeutender feudalistischer Elemente in diesen Ländern bestimmt.
Eine kapitalistische Entwicklung auf nationaler Grundlage konnte, nach dieser Sicht, zumindest bis zu einem gewissen Grade fortschrittlich und damit auch unterstützenswert sein, insbesondere solange es um die (endgültige) Überwindung des Feudalismus ging. Wenn aber die kapitalistische Entwicklung einen gewissen Reifegrad erreicht hat, würden die negativen Effekte der kapitalistischen Entwicklung die Oberhand gewinnen. Sichtbar werden die negativen Effekte in der gegenseitigen feindlichen Abgrenzung der Nationen und den Versuchen, andere Länder zu dominieren. Spätestens dann müssten Kommunisten / Marxisten die Unterstützung nationalistischer Bestrebungen beenden und ihre Politik von müsste wieder ausschließlich vom Internationalismus bestimmt werden.
Ein weiterer Gedanke, der von Lenin propagiert wurde, war die Unterscheidung zwischen den Nationalismen von Unterdrückernationen und den von nationalen Bewegungen der unterdrückten Völker. Erstere seien selbstverständlich abzulehnen, letztere zu unterstützen.
Prinzipiell ist eine solche Unterscheidung nachvollziehbar. In der Realität gibt es aber viele Zwischenstufen und undeutliche Übergänge zwischen diesen beiden Varianten des Nationalismus. Entsprechend schwierig kann die Einschätzung von konkreten Fällen sein.
Aber unter den Bedingungen des Kolonialismus waren die Verhältnisse in den meisten Fällen ziemlich klar. Es war offensichtlich, wer die Unterdrücker und wer die Unterdrückten sind und wer von wem abhängig ist. So ist die Losung „Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker vereinigt euch“ zu erklären. Die Parole wurde 1920 auf dem von der Komintern in Baku organisierten „Kongress der Völker des Osten“ ausgegeben. Sie entsprach auch dem Interesse des noch jungen Sowjetstaates.
Nochmal kurz zusammengefasst: Wenn trotz der grundsätzlichen internationalistischen Orientierung Kämpfe zur nationalen Befreiung positiv beurteilt wurden, hatte das zwei Gründe. Einmal die etwas vage Vorstellung der Abfolge von Entwicklungsstufen (Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus) und zum zweiten den Kampf gegen den Kolonialismus. Das erste Konzept stammt im wesentlichen aus der Analyse des 19. Jahrhunderts, das zweite aus dem beginnenden 20. Jahrhundert.
Was ist eine Nation?
Das Wort „Nation“ ist kein eindeutiger Begriff. Nicht alle, die ihn verwenden, verknüpfen die gleichen Vorstellungen damit, einschließlich aller Nebenbedeutungen und der damit verbundenen Vorstellungen. Obwohl er in vielen europäischen Sprachen als Fremdwort aus dem Lateinischen verwendet wird, hat er dort nicht immer die exakt gleiche Bedeutung. Da bei Übersetzungen meistens der in beiden Sprachen vorhandene Wortstamm „Nation“ weiterverwendet wird, gehen sprachliche Nuancen oft verloren bzw. sie verschieben sich. Das kann durchaus ein Anlass für Missverständnisse und Fehlinterpretationen sein.
Es gibt viele Versuche genauer zu definieren, was eine Nation darstellt und ausmacht. Eine dieser Definitionen, die in der kommunistischen/marxistischen Bewegung großen Einfluss hatte und hat, stammt von Stalin. Sie wurde 1913 erstmals veröffentlicht und fand seitdem in vielen Werkausgaben und als Einzelbroschüre eine weite Verbreitung. Während der „Stalinzeit“ war sie die verbindliche Sprachregelung. Demgemäß ist eine Nation „ eine historisch entstandene, stabile Gemeinschaft von Menschen, entstanden auf der Grundlage der gemeinsamen Sprache, des Territoriums, des Wirtschaftslebens und der sich in der Gemeinschaft der Kultur offenbarenden psychischen Wesensart.“ (Werke, Berlin/DDR 1950, Bd. 2. 272)
Der österreichische Sozialdemokrat Karl Renner setzt die Akzente etwas anders. Er hat mehrere Varianten seiner Definition veröffentlicht. Nach einer Formulierung von 1937 sind Nationen „Menschenmassen, die sich aus der Gesamtheit der menschlichen Gesellschaft im Raume absondern und durch besondere Geschichte, Sprache und Kultur losheben, neben- und widereinander Macht erstreben und Macht üben und so als wollende und handelnde Einheiten auftreten.“ (Die Nation: Mythos und Wirklichkeit, Wien 1964, 28)
Renner betont den Aspekt der Nation als handelnde Einheit stärker als Stalin. Seine Definition passt damit besser auf heterogene Nationen wie z.B. die Schweizer, die bekanntermaßen verschiedene Sprachen sprechen. Andererseits bilden nicht alle Ethnien, die sich durch Sprache und sonstige Gemeinsamkeiten von anderen Ethnien abgrenzen lassen, automatisch auch Nationen. Nationen sind in dieser Sicht nur die Ethnien oder eventuell auch größere Gemeinschaften aus mehreren Ethnien, die auch auf politisch relevante Weise den Anspruch erheben, sich staatlich zu organisieren. Es sind also keineswegs nur eindeutige und objektive Kriterien, die eine Nation definieren. Eine Nation ist letztlich die Gemeinschaft, die eine sein will.
Nationale Selbstbestimmung – ein Recht oder ein sinnvolles politisches Ziel?
In den Diskussionen ist meistens vom Recht auf nationale Selbstbestimmung die Rede. Ein solches ist in der Charta der Vereinten Nationen verankert. Dort sind allerdings auch andere Rechte und Prinzipien verankert, die in Widerspruch zur nationalen Selbstbestimmung geraten können, wie etwa das zur Souveränität und Einheit der Staaten und deren territoriale Unverletzlichkeit. Die jeweiligen Gegner der nationalen Bewegungen berufen sich auch regelmäßig auf diese Prinzipien, um damit ihre eigene Position zu untermauern.
Die nationale Frage ist aber, wie auch alle anderen wichtigen politischen Fragen, in erster Linie keine Frage des Rechts. Viel entscheidender ist die politische Sinnhaftigkeit. Wie passen nationale Forderungen zu den anderen verfolgten Zielen? Fügen sie sich in eine langfristige Strategie ein?
Wenn Marxisten den Anspruch haben, Politik im Interesse der Arbeiterklasse zu machen, muss dieses Interesse auch das entscheidende Kriterium für die Festlegung der Ziele sein. Eine Prüfung und Ausrichtung der politischen Ziele an den grundsätzlichen Kriterien sollte immer wieder erfolgen. Automatismen und die unreflektierte Beibehaltung von „alten“ Forderungen könnten mehr schaden als nutzen.
Wie eine konkrete Einschätzung von nationalen Bewegungen erfolgen könnte, soll an den drei folgenden Beispielen gezeigt werden. Es wird dabei versucht, sich auf die Kernfragen der Problematik zu konzentrieren. Vollständigkeit wird nicht angestrebt.
Katalonien:
Die Grundkonstellation dürfte klar sein. Spanien ist ein entwickeltes kapitalistisches Land -wenn auch keine Großmacht- mit bürgerlicher Demokratie und fest in die Strukturen von EU und NATO integriert. Die katalanische Sonderstellung geht weit in die Geschichte zurück. Sie ist aber nach wie vor besonders durch die Zeit der spanischen Republik und den Kampf gegen die Franco-Herrschaft geprägt. Die Repressionen während der Franco-Diktatur hatten in Katalonien auch den Charakter einer nationale Unterdrückung. Das kann man so sehen.
Die Frage ist aber: was ist davon heute noch relevant? Was sind die Hauptprobleme Kataloniens, Spaniens oder EU-Europas? Wie ist die Lage der Arbeiterklassen, sowohl Kataloniens als auch Spaniens? Zur Lösung welcher Probleme braucht es eine katalanische Nation mit einer entsprechenden staatlichen Eigenständigkeit? Oder ist es nicht so, dass die katalanische Bourgeoisie die Lasten loswerden will, die Katalonien als die reichste Region Spaniens für die ärmeren Teile mittragen muss?
Es ist eine Tatsache, dass in Katalonien die Bewegung für eine Unabhängigkeit stark vertreten ist. Weiter ist Tatsache, dass es dabei auch einen linken Flügel gibt (ERC, CUP). Kommunisten/Sozialisten müssen diese Strömungen natürlich ernst nehmen und sich mit ihnen qualifiziert auseinandersetzen.
Aber das Hauptkriterium muss sein, die Lage aus der Sicht der Arbeiterklasse zu beurteilen. Wohin geht die Entwicklung des modernen Kapitalismus? Was folgt daraus für den Klassenkampf? Was ist am dringlichsten, was sollen die Schwerpunkte der Politik sein, kurzfristig und längerfristig? Wer sind die richtigen Bündnispartner?
Die Auseinandersetzung mit dem spanischen Gesamtstaat um eine katalanische Unabhängigkeit könnte der falsche Schwerpunkt sein. Es könnte sich um Kämpfe der Vergangenheit handeln.
Selbstverständlich sind das Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden müssen. Außenstehende können sich mit ihren Einschätzungen an den Diskussionen beteiligen. Sie sollten sich aber nicht in Entscheidungen einmischen.
Radikaler Szenenwechsel: Kurdistan, Rojava
Vor dem 1. Weltkrieg war der größere Teil der von Kurden besiedelten Gebieten Bestandteil des osmanischen Reiches, ein kleinerer Teil gehörte zu Persien. Die Grenze zwischen diesen beiden Reichen verlief über mehrere Jahrhunderte durch die Wohngebiete der Kurden.
Während des 1. Weltkrieges versuchten die Westmächte (Großbritannien, Frankreich) die im osmanischen Reich aufkommenden nationalen Bewegungen auf ihre Seite zu ziehen, auch mit Versprechungen bezüglich eines zu errichtenden Kurdenstaates. Diese Versprechungen wurden aber nach dem Krieg in keiner Weise eingehalten. Vielmehr wurde das vorher osmanische Kurdengebiet letztlich auf die Länder Türkei (türkische Republik unter Atatürk), Irak (britisches Mandatsgebiet) und Syrien (französisches Mandatsgebiet) aufgeteilt. (Die zum Iran gehörenden kurdischen Gebiete waren nicht betroffen.) Die Geschichte der Kurden in den neu geschaffenen Staaten ist unterschiedlich verlaufen und kann hier nicht ausführlich dargestellt werden. Nur soviel: Im Irak waren sozial konservative Strömungen vorherrschend. Ihr Hauptziel war und ist eine Autonomie innerhalb des Staates Irak. In der Türkei entwickelte sich die PKK zur bedeutendsten kurdischen Gruppe. Die PKK proklamierte einen revolutionären und bewaffneten Kampf. Dieser Kampf wurde und wird bis heute mit wechselnder Intensität ausgetragen. Ein Kampf, der mit großer Härte geführt wird, insbesondere auch vom türkischen Staat. Gleichzeitig beteiligten sich (hauptsächlich) kurdische Parteien an den türkischen Wahlen, zum Teil mit erheblichen Erfolgen. Diese Parteien positionierten sich innerhalb der türkischen Politik eher links.
Syrien war und ist der Staat mit der kleinsten kurdischen Minderheit und stand lange Zeit nicht im Mittelpunkt der kurdischen Bestrebungen. Rojava wurde aufgrund einer Sondersituation ermöglicht. Durch den Aufstand/Bürgerkrieg seit 2011 entstand ein staatliches Machtvakuum, das der PYD und ihren Verbündeten die Etablierung eines weitgehend autonomen Gebiets mit Selbstregierung ermöglichte. Rojava diente auch der Selbstverteidigung gegen die Angriffe durch den „Islamischen Staat“ (IS). Die Machtentfaltung des IS begründete auch das Zweckbündnis mit den USA, die in der Kooperation mit der PYD einen effizienten Weg fanden, um den IS zu bekämpfen und Präsenz und Einfluss in der Region zu markieren.
Rojava ist ein Projekt, das in vieler Hinsicht beispielgebend für die Zusammenarbeit verschiedener Volksgruppen, die Emanzipation der Frauen und die Entwicklung des Landes sein könnte. Diese Feststellung kann man machen, auch wenn man berücksichtigt, dass manche Berichte über Rojava verklärend sind und nicht unbedingt immer die Verhältnisse realistisch spiegeln. Und man kann sich fragen, ob die materielle Basis für einen eigenen Staat wirklich ausreichend ist. Trotzdem, Rojava ist ein Beispiel für eine nationale Selbstbestimmung, das unterstützungswürdig ist.
Aber die Existenz von Rojava ist bedroht. Es wird bedroht von der Türkei, die grundsätzlich keine selbständigen kurdischen Einheiten zulassen will. Und es wird bedroht durch den syrischen Staat, der langfristig kein Sondergebiet dulden dürfte. Der Bündnispartner USA, der bisher vermutlich ein Grund für die relative militärische Zurückhaltung der Türkei und Syriens war, ist längerfristig gesehen unzuverlässig. Die USA haben ihre eigenen machtpolitischen Interessen, am sozialen Experiment Rojava sind sie selbstverständlich nicht interessiert.
Rojava zeigt, wie komplex eine Situation sein kann. Es geht nicht einfach um die nationale Frage der Kurden. Rojava ist ja nur ein kleiner Teil des von Kurden bewohnten Gebiets. Die Kooperation mit anderen Ethnien (arabische und assyrische) ist von wesentlicher Bedeutung. Auf Dauer kann das Erreichte nur gesichert werden, wenn auch mit anderen in der Region relevanten Mächten ein Arrangement gefunden wird.
Aufgrund des Kräfteverhältnis ist zu fragen, ob es nicht das realpolitische Ziel sein müsste, einen Modus vivendi mit dem syrischen Staat zu finden, auch wenn dies mit schmerzlichen Kompromissen verbunden wäre. Wie man hört, gibt es durchaus Versuche in diese Richtung. Ob und wie weit das erfolgreich sein kann, bleibt offen.
Selbstverständlich gilt auch hier, die Entscheidungen müssen die Akteure vor Ort treffen.
Palästina/Israel:
Auch das heutige Palästina/Israel war vor dem 1. Weltkrieg ein Teil des osmanischen Reiches. Im Land lebten vor allem muslimische Araber (ca. 90 %), christliche Araber und Juden. Nach der Entstehung der zionistischen Bewegung, die hauptsächlich eine Folge der andauernden Diskriminierung der Juden in Europa und vor allem in Osteuropa war, wurde die Region immer mehr zum Ziel der Einwanderung von Juden aus Europa.
Während des 1. Weltkrieges gab es von Großbritannien verschiedene Versprechungen, darunter an arabische nationalistischen Kräfte, denen ein eigener Staat in Aussicht gestellt wurde, und an die zionistische Bewegung mit der Balfour-Deklaration über die Errichtung einer nationalen Heimstätte des jüdischen Volkes in Palästina. Nach dem Krieg wurden aber die ehemaligen osmanischen Gebiete unter Großbritannien und Frankreich aufgeteilt, offiziell als Mandate des Völkerbundes. Das Mandatsgebiet Palästina umfasste ursprünglich neben dem heutigen Palästina/Israel auch das heutige Jordanien. 1923 wurde das Gebiet östlich des Jordan als Emirat Transjordanien abgetrennt. Die Briten etablierten dort einen Vertreter der Haschimitendynastie als Herrscher. 1946 lief das Mandat aus und das Land wurde endgültig unabhängig.
Der westlich des Jordans liegende Teil blieb der direkten Herrschaft der Briten unterstellt. Anfangs standen die Briten der Einwanderung von Juden in dieses Gebiet positiv gegenüber. Die Einwanderung verlief in mehreren Wellen und die jüdische Bevölkerung in Palästina wuchs stark an. Konflikte mit der hier seit langem ansässigen Bevölkerung blieben nicht aus. Mit der Zunahme der Konflikte änderte sich auch die Haltung der Briten zur jüdischen Einwanderung. Die Einwanderung und die Möglichkeit des Landerwerbs wurde durch verschiedene Maßnahmen eingeschränkt. Nach mehreren kleineren Unruhen und Aufständen kam es 1936 bis 1939 zum sogenannten großen arabischen Aufstand gegen die Juden und gegen die britische Mandatsmacht. Der Aufstand wurde von den Briten blutig niedergeschlagen.
Auch das Verhältnis der zionistischen Bewegung zur Mandatsmacht wurde wegen der weiterbestehenden Einwanderungsbeschränkungen feindselig. Es kann hier nicht auf Details der folgenden Ereignisse eingegangen werden. Aber festzuhalten ist, dass von Seiten der jüdischen/zionistischen Organisationen vielfach auch terroristische Aktionen gegen Araber und Briten unternommen wurden.
Nach dem Holocaust der Nazis fand der Zionismus in weiten Kreisen, auch in solchen, die ihm vorher distanziert bis ablehnend gegenüberstanden, eine grundsätzliche Akzeptanz. Obwohl der Holocaust eigentlich keinerlei Bezug zu Palästina hatte, schien es für viele danach keine Alternative zum Zionismus mehr zu geben. Auch deshalb hat die Geschichte ab 1947 ihren bekannten Verlauf genommen mit dem Teilungsbeschluss der UNO, dessen Nichtakzeptanz durch die (gerade erst souverän gewordenen) arabischen Staaten, mit der Erklärung der israelischen Unabhängigkeit, dem folgenden Krieg und der Flucht bzw. Vertreibung (Nakba) der Palästinenser. Der Waffenstillstand von 1949 konnte den Konflikt nur einfrieren. Ähnliches gilt auch für die folgenden Kriege und Waffenstillstände. Eine dauerhafte Lösung des Konflikts wurde zu keiner Zeit gefunden. Daran haben auch die zwei Friedensschlüsse Israels mit Ägypten und Jordanien nicht wirklich etwas geändert. Auch alle diplomatischen Initiativen wie etwa der sogenannte Oslo-Prozess scheiterten.
Das heißt aber nicht, dass es seit 1947 keine wesentlichen Verschiebungen der Gesamtkonstellation mehr gegeben hätte. Einmal sind die territorialen Veränderungen zu nennen. Die Besetzung der Westbank, der Golanhöhen und der Sinaihalbinsel durch Israel im 6-Tage-Krieg 1967. Die Räumung der Sinaihalbinsel nach dem Frieden mit Ägypten. Die einseitige Annexion von Ostjerusalem und der Golanhöhen durch Israel und die einseitige Räumung des Gazastreifens.
Ursprünglich war der Konflikt in den Jahren nach 1948 eine direkte kriegerische Konfrontation des neu gegründeten Staates Israel mit seinen arabischen Nachbarn, die wiederum von den anderen arabischen Staaten unterstützt wurden. Eine Folge dieser Konfrontation war auch die Flucht bzw. Vertreibung vieler Juden aus den arabischen Ländern. Für Israel bedeutete das die Einwanderung von über 800 000 Juden aus diesen Ländern und damit eine durchaus relevante Verschiebung der Bevölkerungsstruktur. Inzwischen haben sich etliche arabischen Staaten schrittweise aus der direkten Konfrontation zurückgezogen, siehe die genannten Friedensschlüsse, siehe den sogenannten Abraham-Accord (Anerkennung Israels durch Bahrein, die VAE, Marokko und Sudan) und siehe auch die aktuellen Meldungen über ein eventuell mögliches Abkommen mit Saudi-Arabien.
Der verbleibende Konflikt konzentrierte sich immer mehr auf eine Auseinandersetzung des Staates Israel mit den Palästinensern. Wobei die Palästinenser heute unter ganz verschiedenen Bedingungen leben. Einmal in den von Israel besetzten Gebieten, der Westbank. Neben der Besatzungsmacht ist dort auch die Palästinensische Autonomiebehörde unter Führung der PLO/Fatah als quasi-Staatsmacht tätig. Dann im Gaza-Streifen, jenem staatsrechtlich ganz ungewöhnlichen Gebiet, das faktisch von der Hamas beherrscht wurde. Vor dem 7.10. war der Gaza-Streifen nicht mehr besetzt, aber dennoch in hohem Grade von Israel abhängig und in vielerlei Hinsicht unter dessen Kontrolle. Drittens in den Lagern in mehreren arabischen Ländern, versorgt durch die UNRWA und viertens individuell verstreut in arabischen und sonstigen Ländern. Nicht zu vergessen auch die Palästinenser, die zwar israelische Staatsbürger, aber jüdischen Israelis nicht völlig gleichgestellt sind.
Seit Mitte der 60er Jahre etablierte sich die PLO und die Fatah als die wichtigste Gruppe innerhalb der PLO als Vertretung der Palästinenser. Inzwischen wurde aber die PLO immer deutlicher von der Hamas als der führenden Kraft des Widerstandes abgelöst. Zum Hauptbündnispartner der Hamas wurde der Iran, zusammen mit seinen Verbündeten, wie z.B. der Hisbollah in Libanon, gefolgt von Ländern, die sich als Unterstützer und Förderer der Muslimbrüder verstehen, wie Katar oder die Türkei unter Erdogan.
Es ist richtig und unbestreitbar, die Entstehung Israels ist auch eine Folge des Kolonialismus. Die Idee, in Palästina eine nationale Heimstätte für die Juden zu schaffen, also der Zionismus, konnte vermutlich nur in der Epoche des Kolonialismus so zur Realität werden, auch wenn die Beziehungen der einwandernden Juden zur Kolonialmacht Großbritannien bekanntermaßen keineswegs spannungsfrei waren. Unvermeidbar musste der Aufbau eines jüdischen Gemeinwesens zu Konflikten und zur Konfrontation mit der ursprünglich dort ansässigen Bevölkerung führen, was 1948/49 zur Nakba führte. Eine weitere Flüchtlingswelle gab es 1967. Und es muss betont werden, der Prozess der Verdrängung geht auch heute noch weiter. Tatsache ist, dass 1993 (zum Zeitpunkt des Osloer Abkommens) etwas weniger als 300 000 jüdische Siedler auf der Westbank (und im annektierten Ostjerusalem) lebten. Heute sind es über 700 000 mit weiter zunehmender Tendenz. Ein relevanter Teil der israelischen Politik bzw. der Bevölkerung plädiert auch mehr oder weniger offen für eine weitere Verdrängung bzw. Vertreibung der arabisch-palästinensischen Bevölkerung und für die Annexion von Judäa und Samaria, wie sie diese Gebiete nennen. Selbst im Gazastreifen soll es nach den Vorstellungen dieser Kräfte in Zukunft wieder jüdische Siedler geben. Ein weiterer Teil der Bevölkerung Israels nimmt die harte Linie gegen die Palästinenser zumindest stillschweigend in Kauf. Wie groß zur Zeit der wirklich friedensbereite Teil der Bevölkerung in Israel noch ist, der auch größere Konzessionen an die andere Seite akzeptieren würde, ist schwer einzuschätzen.
Es besteht kein Zweifel: die jetzige Lage aller Palästinenser, auch die der Bewohner der Westbank und der Flüchtlingslager, ist völlig unakzeptabel. Selbstverständliche haben die Palästinenser das Recht zum Widerstand und das Recht, für ihre Interessen zu kämpfen. Allerdings gibt es das Problem, dass die zur Zeit führende Kraft, die Hamas, eine islamistische und weitgehend reaktionäre Bewegung ist. Dies kann man zwar wegen der gegebenen Bedingungen bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, ändert aber nichts an deren reaktionärem Charakter und auch nichts daran, dass die Hamas keine Perspektive für eine Lösung des Konflikts für alle in Palästina/Israel lebenden Menschen bieten kann und wohl auch nicht bieten will.
Trotz der Rolle des Kolonialismus handelt es sich nicht einfach um einen Fall der Dekolonisierung. Auch die jüdische Bevölkerung Israels hat (inzwischen) ein Recht, in Palästina zu leben, sie ist zum großen Teil in diesem Land geboren. Welche Perspektive sollte sie sonst haben, als dort ihr Leben zu gestalten? Daran ändert auch der Kolonialismus nichts. Die Folgen des Kolonialismus lassen sich nicht einfach rückgängig machen, der vorkoloniale Zustand ist nicht wieder herstellbar. Auch die weißen Bewohner von Australien und der USA oder russische Bewohner Sibiriens werden diese Länder nicht mehr verlassen, obwohl deren dortige Anwesenheit eine Folge von Kolonialismus ist.
Ändern, und das grundlegend, müsste sich die Lage der Palästinenser. Für sie müsste es eine realistische Zukunftsperspektive geben, die ein Leben ohne Diskriminierung und ohne Einschränkungen ermöglicht. Das gilt auch für die Menschen, die, versorgt durch die UNRWA, in Lagern in mehreren arabischen Ländern leben. Auch für sie muss eine Lösung gefunden werden.
Eine wirkliche Lösung des Konflikts kann nur auf einer Basis entwickelt werden, die alle Menschen, die in Palästina/Israel leben, einschließt, ein Leben ohne Unterdrückung und Diskriminierung für alle. Voraussetzung dafür ist, dass sich die beiden Bevölkerungen gegenseitig als Menschen respektieren und nur nach solchen Wegen suchen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Alle angestrebten Regelungen müssten die gegenwärtige Situation zumindest schrittweise verbessern und sie müssten offen für weitere Fortschritte sein. Das wären die Minimalbedingungen für einen Prozess hin zu einem dauerhaften Frieden.
Allerdings ist eine solche Entwicklung in keiner Weise in Sicht. Die Hamas steht nicht für eine solche Lösung, auch die gegenwärtige israelische Regierung nicht. Aber auch alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt einigermaßen realistischen Alternativen wie etwa die PLO/Fatah auf Seiten der Palästinenser oder etwa eine Regierung unter Benny Gantz oder Jair Lapid auf Seiten Israels geben keinen Anlass zu größerem Optimismus (die jeweiligen Unterschiede dieser Varianten werden hier nicht im Detail diskutiert). Die gegenwärtige Situation ist offensichtlich sehr verfahren. Dabei ist klar, alle Versuche, den Konflikt einseitig nur zu Lasten der jeweils anderen Seite zu beenden, sind Sackgassen und werden zu weiteren menschlichen Katastrophen führen.
Momentan erscheint höchstens ein Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln und eine Normalisierung der Versorgung der Menschen im Gazastreifen erreichbar. Also ein weiteres vorübergehendes Einfrieren der Kämpfe. Aber auch das ist keineswegs sicher.
In Palästina/Israel stehen sich die beiden Lager auch deswegen so unversöhnlich gegenüber, weil beide die Wahrnehmung haben, es gäbe im Land buchstäblich nur Platz für eine Seite, nur für die Israelis oder nur für die Palästinenser. Und diese Wahrnehmung sehen beide Seiten durch ihre Erfahrungen und durch den Ablauf der Ereignisse immer wieder bestätigt. Deshalb verhärten sich die Positionen. Auch für Kompromisse scheint es keinen Platz zu geben. Die jeweiligen Ansprüche treffen mit voller Wucht aufeinander und beide Seiten sind empfänglich für Ideologien, die propagieren, der Kampf, auch ein solcher mit Einsatz von brutaler Gewalt, müsste bis zum Ende ausgetragen werden.
Das Problem, dass die führende Kraft einer nationalen Bewegung reaktionär sein kann, betrifft nicht nur die Hamas, das gibt es auch anderswo. Man denke nur an die Taliban, die zwar die USA und ihre Verbündeten aus dem Land vertrieben haben, aber mit ihrer Machtübernahme keinesfalls einen gesellschaftlichen Fortschritt garantieren oder auch nur anstreben. Gerade nationale Fragen bieten unterschiedlichen konservativen, rechten und reaktionären Strömungen die Möglichkeit, in entsprechenden Kämpfen eine führende Position zu erlangen. Nationales lässt sich meistens leicht mit der Ausrichtung auf eine angeblich ruhmvolle und bessere Vergangenheit, mit idealisierten religiösen Vorstellungen oder dergleichen mehr verbinden. Solche Tendenzen sind auch keinesfalls neu. Nationalismus war schon immer auch eine Ideologie zur Stabilisierung der Macht von herrschenden Klassen. Eine starke Abgrenzung von anderen Nationen dient oft als Rechtfertigung für deren Beherrschung und Ausbeutung.
Abschließend sollen noch einmal die anfangs dargestellten Begründungen für eine positive Einschätzung des Strebens nach nationaler Unabhängigkeit aufgegriffen werden.
Eine Begründung postulierte, die nationale Unabhängigkeit könnte für die Überwindung des Feudalismus, den Aufbau der Produktivkräfte und für die weitere gesellschaftliche Entwicklung nützlich oder sogar notwendig sein. Diese Argumentationslinie ist sehr stark von den historischen Beispielen aus dem Europa des 19. Jahrhunderts beeinflusst. Es stell sich die Frage nach der Übertragbarkeit dieser Beispiele auf nichteuropäische Länder mit einem anderen historischen Hintergrund. Auch die zeitliche Dimension ist dabei zu beachten. Der Kapitalismus ist nicht mehr der des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts. Außerdem haben sich viele weltpolitische Bedingungen deutlich verändert. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu: generelle Folgerungen oder gar allgemeinverbindliche Regeln können aus den europäischen Beispielen nicht mehr abgeleitet werden.
Die zweite Begründung war der Kampf gegen den Kolonialismus. Die Entkolonialisierung ist (fast) abgeschlossen. Aus den Kolonien sind selbstständige Staaten entstanden. Allerdings gibt es im weltweiten Kapitalismus weiterhin den Unterschied zwischen den Zentren und der Peripherie. Offensichtlich bestehen erhebliche Hemmnisse für eine nachholende wirtschaftliche Entwicklung der ehemaligen Kolonien. Die Entkolonialisierung hat in dieser Hinsicht viele Erwartungen enttäuscht. Offensichtlich ist aber auch, der Grund für diese Hemmnisse liegt im Allgemeinen nicht in der fehlenden staatlichen Unabhängigkeit. Es gibt mehrere theoretische Ansätze (mal mehr, mal weniger marxistisch, nur als Stichwörter: Neokolonialismus, Kompradorenbourgeoisie, Dependenztheorie), die sich mit dieser für die heutige Zeit zentralen politischen Fragestellung auseinandersetzen und versuchen die Ursachen für die weiterbestehende Spaltung in Zentren und Peripherie zu erklären. Wie immer man die Situation im einzelnen analysiert, die Länder der Peripherie sind keine Kolonien mehr, die Situation ist eine andere als im beginnenden 20. Jahrhundert. Deshalb erfordert dies auch andere politische Konzepte. Man kann durchaus der Meinung sein, dass in diesem Zusammenhang noch etliche Fragen ungeklärt sind, aber das ist ein anderes Thema.
Damit soll nicht gesagt werden, dass es grundsätzlich keine unterdrückten Ethnien und Völker mehr gibt. Pauschale Aussagen sind, wie immer, nicht sinnvoll. Aber generell sind Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Entwicklung hin zu immer mehr unabhängigen Staaten angebracht. In vielen Fällen dürfte eine Autonomie, insbesondere eine Autonomie, die die Entfaltung von Sprache und Kultur möglich macht, der sinnvollere Weg sein.
Zur Illustration dieser Aussage soll auf Afrika verwiesen werden. In vielen afrikanischen Staaten leben mehrere Ethnien, die verschiedene, oft auch nicht verwandte Sprachen sprechen und sich auch sonst durch ihre traditionelle Lebensweise erheblich voneinander unterscheiden können. Es ist kaum vorstellbar, wie die Staatenwelt Afrikas ausschauen würde, wenn alle diese Ethnien einen eigenen Staat anstreben würden. Nun könnte man argumentieren, die Grenzen in Afrika wurden von den Kolonialmächten, oft nach der Logik des „Teile und Herrsche“, gezogen und von den unabhängigen Staaten als vorgegeben übernommen. Dies ist sicherlich richtig, aber gibt es denn eine sinnvollere Alternative? Es ist zumindest keine in Sicht. Deshalb wird dieses Thema auch von vielen Akteuren, auch solchen, die sonst politisch sehr verschieden sind, sorgfältig gemieden. Die letzte unter den seltenen Ausnahmen einer allgemein anerkannten Grenzveränderung in Afrika war bisher der Südsudan.
Auch hier gilt, der Kolonialismus lässt sich nicht einfach ungeschehen machen. Viele Folgen und Auswirkungen wirken noch lange weiter. Bis zu einem gewissen Grade muss man mit diesem Erbe leben.
Der Kapitalismus dominiert gegenwärtig weltweit. Die kapitalistische Durchdringung aller Märkte hat einen historischen Höhepunkt erreicht, durch grenzüberschreitenden Handel, durch komplexe Lieferketten, durch das Agieren transnationaler Konzerne und der (weitgehend freien) Zirkulation des Kapitals. Eine internationale Perspektive der arbeitenden Klassen und ihrer Organisationen ist unter solchen Umständen eine Notwendigkeit.
(Stand: 10.06.2024)