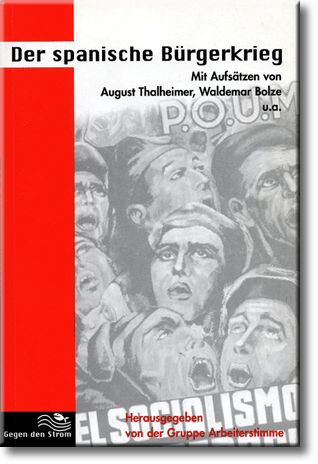Wir haben uns in den letzten beiden Jahren verstärkt mit der veränderten und sich weiter verändernden politischen Situation in Deutschland auseinandergesetzt. Dabei waren wir im Herbst 2024 zum Schluss gekommen, dass das Gesellschaftsmodell der Bundesrepublik nicht nur in eine Krise geraten ist. Es ist im Begriff, auf vielen Ebenen mit den bisherigen Regeln zu brechen und das Verhältnis der Klassen zueinander sowie die Rolle, die der Staat innehatte, der sich bisher auch als Sozialstaat definierte, neu zu justieren. Dies betrifft alle Institutionen staatlicher Organisation genauso wie etwa das Parteienspektrum, seine Akzeptanz bei der Wählerschaft und - erst einmal als wenig systematischer Reflex – die Programmatiken der Parteien selbst.
Die neue Regierung ist …
keine Traumhochzeit. Auch als Vernunftehe lässt sich die Beziehung beider Regierungspartner zueinander kaum bezeichnen. Der am besten passende Begriff ist, wenn man die Umstände der Partnerfindung berücksichtigt, die Zwangsheirat.
Beide Parteien haben sich nicht gesucht und doch gefunden. Nach dem Wahlergebnis der Bundestagswahl vom 23. Februar war keine andere mehrheitsfähige Regierungsbildung mehr möglich als CDU/CSU und SPD. Mit den so sehr willigen GRÜNEN reicht es weder für die einen noch die anderen und die FDP, das zu allem fähige „Zünglein an der Waage“, scheiterte deutlich an der Prozentklausel. Dass die schwarz-rote Koalition überhaupt eine Mehrheitschance erhielt, lag am hauchdünnen Ergebnis des BSW. Von keiner Seite politisch angestrebt und in der Bevölkerung, laut Umfragen, äußerst skeptisch betrachtet, soll eine Regierung neu aufgelegt werden, die früher, als diese Vokabel noch ihre Berechtigung hatte, „Große Koalition“ genannt wurde. Inzwischen geht man rechnerisch mit einem Vorsprung von 12 Stimmen in eine vierjährige Regierungszeit.
Dass die negativen Vorerwartungen mit dem Kanzlerkandidaten Merz zu tun haben, ist kein Geheimnis. Ihm persönlich wird von vielen angelastet, dass der geplante Coup der Bundestagsentschließung zur Migration Mehrheiten mit der Hilfe der AfD praktisch möglich machte. Ihm persönlich wird angelastet, dass die Schuldenbremse, im Wahlkampf ein No-Go, plötzlich keine Rolle mehr spielt. Selbst wenn juristische Interpretationen die Bremse formal für intakt befinden, weiß doch jeder, dass Schulden in einer vierstelligen Milliardenhöhe aufgenommen werden und diese damit unweigerlich bedient werden müssen. Bei steigenden Zinsen und über viele Jahrzehnte. Diese persönliche Schuldzuweisung mag nicht politisch gedacht sein, aber sie wirkt eben nach.
Gleichzeitig steigen die Erwartungen, die mit einer neuen Regierung verknüpft werden, praktisch täglich. Die Wirtschaft soll wieder ins Laufen kommen nach drei Jahren ohne jedes Gesamtwachstum, der Krieg in der Ukraine ist trotz oder wegen der permanenten Waffenlieferungen zu keinem Ende gekommen, die Migrationsfrage ist national wie EU-europäisch in keiner Weise einer Lösung nähergebracht, der Hauptverbündete und größte Handelspartner der Bundesrepublik, die USA, sind im Umbau und die Folgen davon sind ungewiss. Deshalb sind auch die Reaktionen darauf kaum planbar. Sicher ist nur, dass weder Deutschland noch das politische Europa zur Zeit der Player auf der Weltbühne sind, der sie sein wollen. Der Weg dahin ist steiniger und unsicherer denn je, es reicht eben nicht, von der Multipolarität der Weltordnung unter Einschluss Europas zu schwadronieren, wenn Kameras und Mikrophone offen sind.
Einig waren sich CDU/CSU und SPD auf der Ebene der Parteispitzen darin, dass
die Regierungsbildung schnell zu gehen hat. Erst wenn es schnell gehe, könne man die Verantwortung tragen, die jetzt auf den Parteien liege. Offensichtlich spielt es keine Rolle, dass eben dieselben Parteien den „Vertrauensverlust“ herbeigeführt haben. So jedenfalls die gängige Lesart der gegenwärtigen Krise des bürgerlich-demokratischen Politikmodells, die die tieferreichenden Ursachen nicht zur Kenntnis nehmen mag. Warum ist Putin nicht gescheitert und Selenskyj nicht auf dem Weg zum Sieg, den man so vollmundig herbeireden wollte? Warum haben die USA die Regierung, die sie haben? Warum sieht der kollektive Westen jetzt einfach zu,
wenn die israelische Regierung den Gazastreifen räumen und annektieren will und damit nach der Tötung zehntausender Palästinenser, nach der Bombardierung syrischer Ziele eine neue Flüchtlingssituation erzeugt, die -zurückhaltend formuliert- auch Europa betreffen wird? Viele dieser Fragen sind alle zusammen Ausdruck der Hilflosigkeit und des Scheiterns eines Politikansatzes, der über Jahrzehnte Frieden und relativen Wohlstand in Westeuropa und Nordamerika sowie wenigen weiteren Staaten erzeugt hat. Aber nur dort, nicht bei der Mehrzahl der Weltbevölkerung.
Seit dem Aufstieg Chinas und anderer bedeutender Staaten der südlichen Hemisphäre gilt dieses universalistische Diktum nicht mehr. Die parlamentarische Demokratie im Duett mit der neoliberalen kapitalistischen Wirtschaftsform, deren Regeln im Westen entwickelt und durchgesetzt wurden, ist nicht mehr das Maß der Dinge. Die Reaktion darauf ist in Deutschland wie im politischen Europa der Trotz. „Unsere Werte“ sind noch immer Maßstab des Wohlverhaltens vieler Länder nach „unserer“ Ansicht und wirken damit unmittelbar auf deren Lebens- und Überlebensfähigkeit ein. Die Grenzen der widerwilligen Akzeptanz dieser fremden Vorgaben sind jetzt erreicht und mancherorts auch überschritten. Selbst an den Rändern der EU, dort wo die wirtschaftlich-gesellschaftliche Krise schon länger wirkt und wütet, sind „unsere Werte“ nicht mehr das, was sie mal waren.
Ob „wir“ aber „unsere Werte“ noch alle teilen oder etwa der Begriff Demokratie nicht nur unterschiedliche Schattierungen, sondern konträre Inhalte angenommen hat, diese Frage wird in den letzten Jahren zunehmend so beantwortet, dass die Parteien der Mitte nicht mehr zufrieden sein können. Hektisches, vordergründiges Handeln und grundsätzlicher Streit auf offener Bühne sind die Folgen, nicht die Ursachen der Politikverdrossenheit. Der Begriff ist zwar nicht mehr modern und war eher dazu gedacht, eine zunehmende Wahlabstinenz anzuzeigen. Eine zu geringe Wahlbeteiligung ist gegenwärtig aber kein Problem mehr. Früher hat man Wahlerfolge außerhalb der Mitte damit erklärt, dass die „Ränder“ ihre Klientel besser mobilisieren konnten und die etablierte Wählerschaft zufrieden daheimgeblieben sei. Das war vielleicht nicht schön, aber kein Grund zur Beunruhigung. Heute stehen dieselben Erklärer von früher einer steigenden Wählermobilisierung gegenüber, die der AfD einen Erfolg nach dem anderen beschert. Unter diesen Rahmenbedingungen ein Politikangebot zu entwickeln, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfolge hervorbringt und satte Mehrheiten schafft (wie früher!), das wird keiner gegenwärtigen Parteienkonstellation mehr zugetraut. Das fehlende Vertrauen ist also kein Problem mehr, das sich auf bestimmte, mehr oder weniger zahlreiche Personen bezieht. Es ist Misstrauen gegen ein System, das beständig Enttäuschungen hervorrufen muss, das aber im Denken vieler, nicht nur von AfD-Anhängern, ohne Konkurrenz dasteht. Alternativlos, selbst bei einer erstarkenden Alternative für Deutschland, sozusagen.
Das Wahlergebnis vom Februar 2025 sucht sich also die (einzig) mögliche Regierungskonstellation und deshalb ist der Begriff Verantwortung auch das Lieblingswort der vier VerhandlungsführerInnen: Verantwortung für Deutschland.
Die Zeichen sind auf Abwehr, Verteidigung des Status Quo und die Begrenzung negativer Folgen der Weltpolitik gestellt, das beschränkt die Gestaltungskraft auf all den Ebenen, die die Mehrheit der hier Lebenden betreffen, entscheidend.
Das zur Regierungsbildung nötige Procedere war schnell ausgepackt. Mehrere Teams beider Seiten formulierten und verhandelten den Koalitionsvertrag nach Themen ab. Ein paar Wahlversprechen sollten es schließlich in den Vertrag schaffen, Näheres dazu später.
Während die Verhandlungen in die Zielgerade einmündeten, wie man in einem Autoland so gerne sagt, wurden einige Personalien durchgestochen: wer wird was und wer wird nichts, weil sie wohl die bequemste Schuldige an der Wahlschlappe der SPD ist? Am eiligsten hatte es die CSU. Parteivorstand, Landesgruppe im Bundestag und Fraktion im Landtag stimmten sofort und einstimmig zu. So geht Einigkeit, wenn Spitzenpositionen in der Regierung winken. Gut zwei Wochen später war die CDU dran. Ein Kleiner Parteitag mit 150 Delegierten stimmt in so großem Maße zu, dass der Sitzungsleiter, Michael Kretschmer aus Sachsen, ganz überwältigt war. Ob es Gegenstimmen oder Enthaltungen gab, war laut Tagesschau nicht zu ermitteln. So geht Demokratie, wenn als Belohnung die Kanzlerschaft winkt.
Nur die SPD machte es sich mit einer Mitgliederbefragung nicht ganz so leicht. Zwar war die Zustimmungsrate mit 85% durchaus beachtlich, doch hatten nur 56% der Parteimitglieder daran teilgenommen, sehr viel weniger als bei der letzten Abstimmung 2021. Die Skeptiker enthielten sich also, um nicht zugleich der Parteiführung das Misstrauen aussprechen zu müssen. Aber sie werden ihre Skepsis gegen die vereinbarte Ausrichtung der Politik nicht aufgegeben haben. Bei den künftigen Belastungen und Härten, die die SPD mitzuvertreten und durchzusetzen hat, wird sich diese Entfremdung wieder bemerkbar machen.
Trittstufen für das Brandmäuerchen
Der rosa Elefant im parlamentarischen Raum ist zweifellos die AfD. Auch wenn man ihren Namen nicht nennen mag, so ist ihr Vorhandensein immer ein Thema. Man möchte die „gesichert Rechtsextremen“, so das Qualitätssiegel des Inlandsgeheim-dienstes, bekämpfen, und zwar rein demokratisch, mit „guter Politik“ (Markus Söder). Falls dies aber doch nicht so gut klappt, sollte man das Pack besser verbieten. Oder ihnen die Staatsknete entziehen. Oder vielleicht doch nicht?
Die Politik gegenüber den Rechten gleicht einer Springprozession, vor und zurück hängen unmittelbar zusammen. Die scheidende Innenministerin hatte als letzten Gruß an die Neuen eine ziemlich eindeutige Einschätzung der AfD durch den Geheimdienst hinterlassen. Die „demokratische“ Opposition nahm diese Steilvorlage gerne auf und tat sich schnell mit der Forderung nach einem Verbotsverfahren hervor. Die neu Regierenden sind da wesentlich zurückhaltender, dafür gibt es viele Gründe. Nicht nur der Zeitbedarf für ein solches Unterfangen und damit die Frage, wie man sich in der Zwischenzeit verhält, sind schwer einzuschätzen.
Welches Bild vermittelt man der deutschen Öffentlichkeit damit, wenn Jahre ohne Entscheidung vergehen? Im Zusammenhang mit dem beabsichtigten NPD-Verbot ist die Politik noch über andere Hürden gepurzelt, und der kleine Haufen Nazis mit Anhang war im Verhältnis zur AfD höchstens das Vorprogramm. Auch die Quellen und die Spitzel möchte man ungern riskieren für eine bloß bescheidene Chance auf Parteienverbot.
Eine tiefere Ursache der Zurückhaltung in der Verbotsfrage liegt sicher darin, dass Kernelemente der Politik der Regierungsparteien und des Programms der AfD sich gleichen. Chrupalla wird nicht müde, bei jedem Interview (und davon gibt es nicht wenige!) darauf hinzuweisen, dass Merz die Forderungen der AfD in seinen Wahlkampf übernommen hat. Da ist einiges dran. Allein, die CDU wolle diese richtigen und “vernünftigen“ Maßnahmen immer noch nicht mit einer komfortablen parlamentarischen Mehrheit in Gesetze gießen. Die AfD sei dazu bereit und wenn man den Umfragen glauben kann, mindestens 30% der Bevölkerung auch. (statista-Umfrage Ende Januar 2025) Das Problem liegt also nur zum Teil in der Partei, es liegt in ihrer Wählerschaft. Wie reagiert sie, wenn eine Zusammenarbeit dauerhaft blockiert wird? Verlieren die Wähler die Lust am „Denkzettel Verteilen“ und ziehen sich wie zuvor in die Passivität zurück? Oder finden sie andere Wege, ihrer Abscheu gegen die etablierte und enttäuschende Politik Ausdruck zu verleihen? Nach Stabilität sieht beides nicht aus und die Wählerschaft der Rechten, Fleisch vom Fleische der jetzt und vorher regierenden Parteien, kann das Regieren auch ohne AfD sehr ungemütlich werden lassen.
Der Versuchsballon von Merz, doch einmal von der Mehrheit mit Hilfe der AfD zu kosten, hatte für ihn, seine Partei und das Verhältnis zu den möglichen Koalitionspartnern verheerende Folgen, das wird er so schnell nicht nochmal versuchen. Trotzdem schickt er den Spahn, Fraktionssprecher der CDU, vor, um zu testen, wie eine mögliche „Normalisierung“ des Verhältnisses zur AfD in der parlamentarischen Arbeit von den anderen Parteien aufgenommen wird. Bislang nicht gut, muss man konstatieren. Garantie ist das keine.
Die neue Regierung wird ihre Aufgaben mit den genannten Belastungen angehen müssen, die inneren und äußeren Begrenzungen werden die Erfolge sehr eng abstecken. Wenn die beiden einander äußerst misstrauenden Partner die Regierung dann vollziehen, möchte man beiden Seiten zurufen: Macht die Augen zu und denkt an Deutschland!
Gemeinsame Verantwortung, gemeinsame Absichten, getrenntes Scheitern?
Ein Vertragswerk über 140 Seiten in wenigen Wochen verhandlungsdicht zu machen, in dem belastbare Zielvorgaben für vier Jahre versammelt sind, ist keine geringe Aufgabe. Voraussetzung wäre schon einmal ein schonungsloser Kassensturz, der die materielle Basis für die anstehenden Vorhaben darstellt. Diesmal spielen die Finanzen eine merkwürdige Doppelrolle. Einmal sind sie, ohne konkrete Angaben zu liefern, der große Bremsklotz, „Finanzierungsvorbehalt“ genannt. Alles, was mit sozialen Aspekten und staatlicher Daseinsvorsorge zu tun hat, steht unter dem Spardiktat der Koalitionspartner. Im Gegensatz dazu schweben Investitionsfonds-Pläne durch einzelne Finanz- und Wirtschaftskapitel, die kaum Grenzen nach oben kennen. Ein Deutschlandfonds soll mit 10 Milliarden Bundesmitteln ausgestattet werden, der fehlendes Investitionskapital ausgleicht. Dort, wo also die „privaten Finanzmärkte“ nicht oder nicht genug einsteigen, da sollen „mithilfe von privatem Kapital und Garantien … die Mittel des Fonds auf mindestens 100 Milliarden Euro“, so heißt das im Bankerdeutsch, „gehebelt“ werden (Koalitionsvertrag 2025, S. 4f.). Das Finanzkapital wird sich diese Hebel gut entlohnen lassen, ob durch Rückzahlungen oder Steuervorteile. Es wimmelt von Sätzen im reinen Finanzsprech, z.B. „Wir unterstützen Moonshot-Technologien auch über meilensteinbasierte Finanzierungsinstrumente.“ (S.5) Ob das alle Abstimmenden über die Vertragsannahme auch verstanden haben?
„Hebeln“ tun sie überhaupt gerne, auch beim „Zukunftsfonds“. Da sollen „Investoren“ die Kapitalausstattung einfach verdoppeln, dann hebelt eben mal der Bund. Auch als Laie versteht man: Erstens, Geld spielt in dieser „Investitionsoffensive“ (S.4) keine Rolle, das wird vorausgesetzt. Und zweitens, es wird teuer.
Dass die Fahrzeugindustrie Thema ist, muss natürlich sein. Zehntausende von Arbeitsplätzen kippen jetzt schon weg und die Arbeitenden haben ein Recht darauf, zu erfahren, was die Regierung zu ihrer Unterstützung plant. „Wir bekennen uns klar zum Automobilstandort Deutschland und seinen Arbeitsplätzen.“ (S.7) Das war es dann aber schon für die Kolleginnen und Kollegen, außer sie kaufen sich jetzt endlich E-Fahrzeuge oder nutzen sie wenigstens als Dienstwagen, dann können sie auf 100 000 Euro-Modellen die steuerlichen Begünstigungen genießen. (S.7) Die Autowerker sollten ihre letzte Chance nutzen: „Wir prüfen daher, wie die Umrüstung und Ertüchtigung vorhandener Werke für die Bedarfe der Verteidigungsindustrie unterstützt werden können.“ (S.8) Warum nicht mal Kampfpanzer statt SUVs produzieren?
Technologieoffen will man ja sein, weltoffen selbstverständlich auch. Einige Betroffene werden dabei wohl ins Gras beißen: die „freiwilligen Aufnahme-programme“ werden beendet. Gerade die afghanischen Helferlein bei allen möglichen Aufgaben, die es nicht mehr in das letzte Baerbock-Kontingent geschafft haben, dürfen sich auf eine problematische Zukunft bei den Taliban einrichten. Und ihre Frauen sowieso. Denn der Familiennachzug wird, Stand 2025, auf zwei Jahre
ausgesetzt. Grenzkontrollen sind zur Begeisterung der Nachbarstaaten auszuweiten und Asylgesuche können anderswo, aber nicht mehr in Deutschland gestellt werden. Ganz streng nach europäischen Regeln wird kontrolliert, zurückgewiesen und rückgeführt, auf dass die AfD-Wählerschaft erkennt, wer hier die Guten sind. (S.93)
Dass hier die neue Regierung einen großen Schritt nach rechts macht, ist unübersehbar. Wo die Sozialdemokratie in dieser Frage steht, die bei all dieser staatspolitischen Verantwortung kaum noch ihr eigenes Programm erinnert, ist klar und eindeutig. Die bisherigen Grundlagen sozialen und verantwortlichen Handeln werden nicht komplett und in einem Zuge aufgegeben, sie werden aufgeweicht und ausgehöhlt, uminterpretiert und mit neuem Politgeschwurbel zugetextet. Das ändert den Standort der Republik, ändert das Denk- und Sagbare im öffentlichen Leben und bereitet weitere Tabubrüche vor, wenn die stattgefundenen nicht ausreichen sollten.
Die Merz- und Söder-Parteien sind nur die Speerspitze der bürgerlichen Entwicklung, die SPD versucht auf allen Gebieten Schritt zu halten und doch noch ein paar Pünktchen durchzubringen. Aber die Sozialdemokraten sind bei all diesen Verschärfungen und Verschlechterungen für die Lohn- und Rentenabhängigen, die Hilfsbedürftigen und Schwächeren dabei. Und deshalb werden sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Die östlichen Bundesländer und Bayern machen es vor, die SPD muss keine 10% erreichen. Da ist noch Luft nach unten.
Eine Probe für den Umgang mit sozialdemokratischen Herzensangelegenheiten gefällig? Wie wär’s mit Löhnen und Arbeitszeiten? „Wir stehen zum gesetzlichen Mindestlohn.“ (S.18) Das ist schön, auch ein Anstieg ist wohl kein Teufelswerk mehr. Aber die plakativen und plakatierten 15 Euro pro Stunde hängen erstmal in der „starken und unabhängigen Mindestlohnkommission“ fest. Wenn dann die Gesamtabwägung und die Tarifentwicklung und der Bruttomedianlohn nichts dagegen haben, könnte „auf diesem Weg … ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 (Anfang? Mitte? Ende?) erreichbar“ sein. Wachsweicher geht es kaum. Immerhin soll ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg gebracht werden. Schon bei
Vergaben ab 50 000/100 000 Euro soll das Gesetz greifen, nicht darunter. Und die Bundesländer sind ebenfalls nur in Ausnahmefällen dabei. Die neue Regierung wird die älteste Arbeitszeitforderung der Arbeiterbewegung in Deutschland schleifen. 8 Stunden sind kein Tag mehr, eine wöchentliche Höchstarbeitszeit soll’s richten. Die SPD stimmt natürlich zu.
Wer im Koalitionsvertrag „Vermögensabgabe“ oder „Erbschaftssteuer“ eingibt, erhält null Treffer. Der Anteil der Reichen, der als Steuer in das öffentliche Budget zurückfließen müsste, ist und bleibt ein Tabu in Deutschland. Mit der Formel, es gebe mit der Regierung keine Steuererhöhungen, wird diese Forderung abgeräumt, die ein wichtiger Baustein sowohl für die Begrenzung des Schuldenhaushalts als auch für das Gerechtigkeitsempfinden der Mehrheit ist. Und die SPD schaut zu und unterschreibt.
Was in der letzten Wahlperiode Bürgergeld war oder besser, sein sollte, wird künftig eine Grundsicherung für Arbeitssuchende (S.16). Ziel ist die Arbeitspflicht für möglichst viele Betroffene, die Qualifizierung und die Gesundheitsförderung sind nachrangig.
Man kann an diesen und vielen anderen Beispielen aufzeigen, dass der Sozialstaat seine Klauen zeigt und jede einzelne, die das Pech hat, den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht zu genügen, es sehr viel schwerer haben wird, eine menschenwürdige Existenz in Deutschland zu führen.