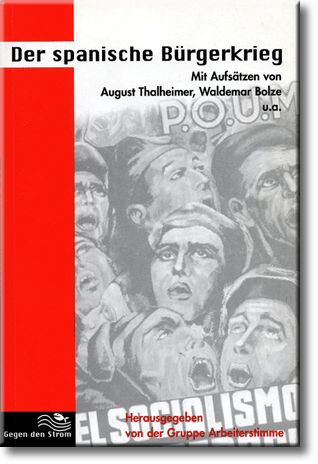Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar 2025 sorgt Donald Trump ständig für Aufregung in den hiesigen Medien. Egal, ob es der Umgang mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi ist, ein neuer Kurs gegenüber Russland, spektakuläre Abschiebungen nach El Salvador, die nicht mehr so ganz klare Haltung zur NATO oder die Zollpolitik - Trump ist ständig in den Schlagzeilen.
Im Folgenden wird versucht eine grundsätzliche Einschätzung vorzunehmen. Was bedeutet die Politik von Trump, auf welcher Grundlage funktioniert sie, wie ist sie einzuordnen? Dagegen wird nicht versucht, auf alle seine Aktivitäten im Detail einzugehen. Das würde die Darstellung sprengen. Die im Vergleich zur Biden-Administration veränderte Haltung der USA zum Ukraine-Krieg und zu Russland wird kurz angesprochen, aber nicht in die Tiefe gehend untersucht.
Alle ökonomischen Fragen (Handelsbilanzdefizit, Staatsverschuldung und insbesondere die Zollpolitik) werden in der nächsten Nummer der Arbeiterstimme mit einem eigenen Artikel ausführlicher behandelt.
Zuerst gilt es festzustellen, das Phänomen Trump und sein spezieller Politikstil ist zwar in gewisser Weise einmalig, aber viele andere Aspekte der Entwicklung, die in den USA zu beobachten ist, sind nicht auf die USA beschränkt.
Schon seit geraumer Zeit ist in vielen Ländern des sogenannten Westens das Erstarken von ausgesprochen rechten, meistens als rechtspopulistisch bezeichneten Parteien zu beobachten. Das Erstarken dieser Parteien hat in den betroffenen Ländern eine deutliche Verschiebung der politischen Landschaft nach rechts bewirkt. Eine solche Rechtsentwicklung ist auch in den USA festzustellen, getragen von den Republikanern unter Trump. Diese kann man als die für die USA spezifische Version des Rechtspopulismus ansehen.
Die Bezeichnung Rechtspopulismus wird verwendet, obwohl der Begriff zugestandenermaßen nicht ganz unproblematisch ist. Aber als Arbeitsbegriff erscheint er brauchbar und nur als solcher soll er hier verwendet werden.
Kurze Beschreibung des gegenwärtigen Rechtspopulismus
Im Folgenden soll kurz und stichpunktartig benannt werden, was für den gegenwärtigen Rechtspopulismus charakteristisch ist. Damit kann überprüft werden, ob diese Charakteristika auch für die USA und die heutige Republikanische Partei zutreffend sind.
Die Ablehnung von Zuwanderung ist ein ganz wichtiger, sozusagen identitätsstiftender Punkt. Die Propaganda konzentriert sich zwar hauptsächlich auf bestimmte Aspekte der Migration, z.B. auf die echt oder angeblich illegale Zuwanderung oder sie fokussiert auf bestimmte Gruppen wie etwa Muslime (Europa) oder Mexikaner (USA). Hintergrund ist oft eine generelle Ausländerfeindlichkeit. Das gilt auch für das Einwanderungsland USA. Siehe die Mauer an der Südgrenze, die Hetze von Trump gegen Mexikaner, die demonstrativen Abschiebungen usw..
Für die Propaganda der Rechtspopulisten spielt die Gegnerschaft zu bestimmten Erscheinungsformen der westlichen, liberalen Gesellschaften eine wichtige Rolle. Beliebte Feindbilder sind das Gendern, die sogenannte Wokeness-Kultur und alles, was mit LGBTQ+ zusammenhängt. Weitgehend abgelehnt wird auch der Feminismus, insbesondere jegliche Quotenregelung. Ein Verbot der Abtreibung wird befürwortet.
Ein positiver Bezug wird dagegen hergestellt zu allem, was zur Abgrenzung vom oben Genannten dient: Die traditionelle Familie, echte Männlichkeit und vieles mehr, bis hin zur Verteidigung von Flugreisen, Fleischessen, Autofahren und anderen „normalen“ Tätigkeiten bzw. Einstellungen, deren Abwertung durch die gesellschaftliche Gegenseite teilweise erlebt, oft aber einfach unterstellt wird.
Die anti-progressive Ideologie hat eine wichtige Funktion. Sie erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Anhängern und erlaubt eine Abgrenzung von der Gegenseite. Viele finden in diesem Katalog etwas, was sie persönlich anspricht und eine emotionale Brücke zum Anschluss an den Rechtspopulismus bereitstellt.
Nicht nur der Begriff „woke“ kommt aus den USA, auch die Gegenbewegung ist dort inzwischen stark geworden.
Charakteristisch für Rechtspopulisten ist die offene Leugnung des von Menschen (durch CO₂ -Ausstoß) verursachten Klimawandels oder zumindest eine starke Relativierung dieser Zusammenhänge. Dementsprechend wird die fossile Energieerzeugung verteidigt und die Maßnahmen zur Klimatransformation werden abgelehnt. Zumindest werden solche Maßnahmen als stark übertrieben und schädlich für die Wirtschaft eingestuft.
Bekanntlich sind die USA jetzt bereits zum zweiten Mal aus dem Pariser Abkommen zur CO₂-Reduzierung ausgetreten. „Drill Baby Drill“ ist ein beliebter Slogan von Trump.
Marktwirtschaft, Kapitalismus und Privateigentum werden als völlig selbstverständlich vorausgesetzt und in keiner Weise in Frage gestellt. Man nimmt für sich in Anspruch, die Interessen der Kleinbetriebe und des Mittelstandes besonders zu vertreten. Generell werden tiefe Steuern und ein schlanker Staat befürwortet.
Diese grundsätzliche Bejahung der kapitalistischen Gesellschaft wird modifiziert durch ein ideologisches Element, das zur Abgrenzung gegenüber einzelnen Erscheinungsformen der bestehenden Verhältnissen dient, nämlich die Kritik an den „Eliten“. Das ist ein bewusst schwammiger Begriff, der alle umfassen kann, die eine gewisse Machtstellung innehaben. Auch Experten und Intellektuelle, die einen etwas größeren Bekanntheitsgrad erreichen, können der Elite zugerechnet werden. Insbesondere gehören auch etablierte Medien dazu („Lügenpresse“, „Fake News Media“). In diesem Zusammenhang werden auch die Begriffe „System“ oder „deep state“ = „Tiefer Staat“ gebraucht. Diese wären die eigentlichen Inhaber der Macht und würden den Volkswillen verfälschen.
Die Skepsis gegen die etablierten Medien ist nicht selten kombiniert mit grenzenlosem Vertrauen in obskure Quellen. Die Rechtspopulisten sind oft die politische Heimat für viele Anhänger von unkonventionellen Ansichten (z.B. Impfskeptiker, UFO-Gläubige, Anhänger von Verschwörungstheorien etc.).
Nicht zuletzt wird ein ausgeprägter Nationalismus gepflegt. „America first“ ist ein typisches Beispiel dafür. Nationalismus dient auch zur Abgrenzung vom sogenannten „Globalismus“. Von diesem würden angeblich die „Eliten“ profitieren und nicht die „kleinen Leute“ oder das einfache Volk.
„Globalismus“ und „Eliten“ sind typische Begriffe einer die Realität vernebelnden Pseudokritik. Mit der Agitation gegen „Globalisten“ und „Eliten“ kann man Erscheinungsformen und Folgen des Kapitalismus angreifen, ohne den Kapitalismus als solchen benennen zu müssen.
Typischerweise sind die rechtspopulistischen Parteien ein Bündnis aus verschiedenen rechten und konservativen Tendenzen, Strömungen und Gruppierungen. Die Bandbreite ist groß, sie kann von gemäßigten Konservativen, über Rechtsstehende aller Schattierungen bis zu den extremsten Rechten und offen faschistischen Kräften reichen. Zu letzteren besteht meist ein ambivalentes Verhältnis. In offiziellen Verlautbarungen wird die Nähe zu Faschisten bestritten. Die vermeintlich klare Abgrenzung wird aber relativiert durch das Aussenden von mehr oder weniger verdeckten Signalen, die in etwa folgende Botschaft enthalten: „Wir müssen uns zwar irgendwie abgrenzen, aber ihr gehört trotzdem zu uns“. Vielleicht noch ergänzt mit „Vermeidet ein allzu provokatives Auftreten.“
Die Begnadigungen aller wegen des Sturms auf das Kapitol Verurteilten durch Trump ist ein geradezu idealtypisches Beispiel für ein solches Signal.
Die konkrete Zusammensetzung der Parteien ist gemäß der Geschichte und der Tradition von Land zu Land verschieden, genauso wie das politische Gewicht und die Verankerung in der Bevölkerung. Nicht allen Fragen kommt in allen Ländern die gleiche Bedeutung zu. Verschieden ist auch ihre Stellung im Parteiensystem, z.B. ihre Akzeptanz als Koalitionspartner. Mancherorts sind sie inzwischen als mehr oder weniger „normale“ Partei akzeptiert, teilweise existiert noch ein Vorbehalt oder eine Brandmauer bezüglich einer Zusammenarbeit.
Eine wichtige Feststellung gilt es noch zu machen. Zu den Anhängern und Wählern der Rechtspopulisten gehören auch Lohnabhängige und Arbeiter. Ein erheblicher Teil der Arbeiterklasse wählt inzwischen rechtspopulistische Parteien.
Wenn von Arbeiterklasse die Rede ist, ist das nur im Sinne einer Klasse an sich gemeint. Die Situation der Lohnabhängigen in den Ländern des Westens ist von vielerlei internen Spaltungen geprägt. Spaltungen bezüglich der konkreten Arbeitsbedingungen (Lohn, Qualifikation, Stärke/Schwäche von Gewerkschaften) und der Einbindung in das gesellschaftliche und politische Umfeld. Eine bewusste Klasse ist nur in Ansätzen vorhanden.
Die Gründe für das Erstarken des Rechtspopulismus können hier nur kurz skizziert werden. Die entwickelten Industrieländer befinden sich seit etlichen Jahren in einer Phase der Stagnation, die Probleme und Krisen häufen sich. Die traditionell maßgeblichen Parteien (sowohl in ihrer konservativen, sozialdemokratischen, liberalen oder auch grünen Ausrichtung) können keinen überzeugenden Weg aus dieser Situation anbieten. Sie bestätigen dieses Unvermögen durch ihr Regierungshandeln immer aufs Neue. Ihr Handeln erscheint vielen als Durchwursteln ohne wirkliche Perspektive. Die Linke (zu verstehen als alle Kräfte, die eindeutig links von den Sozialdemokraten und den Grünen zu verorten sind) ist schwach und in sich heterogen, insbesondere fehlt ihr eine starke Verankerung in der Arbeiterklasse. Dort ist auch kaum ein antikapitalistisches Bewusstsein vorhanden. Die Linke kann zur Zeit mit Antikapitalismus und Sozialismus nicht genügend punkten. Deshalb kann sie auch keine führende Rolle in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einnehmen. Die historischen Erfahrungen und der Zusammenbruch der realsozialistischen Länder scheinen weiterhin zur Diskreditierung von Sozialisten oder Kommunisten auszureichen.
Die Krisen und Probleme nehmen zu, allerdings geschieht das meistens schleichend. Für die Länder des „Westens“ ist eine große, katastrophale Krise bisher ausgeblieben, sie erscheint nur ständig drohend am Horizont. Alle haben das Gefühl, dass die Lage in Zukunft noch schlechter werden wird und suchen nach einen Ausweg, ohne einen solchen klar vor Augen zu haben. In dieser Situation können die rechtspopulistischen Parteien sich als (scheinbarer) Ausweg anbieten. Sie positionieren sich einerseits gegen die „Eliten“, gegen das „System“ und seine „Systemparteien“ und setzen sich damit von den gegenwärtigen Verhältnissen mit ihren vielen Problemen ab, andererseits wollen sie aber das Gewohnte und Bekannte erhalten bzw. wieder in eine als besser erlebte Vergangenheit zurück. Sie appellieren an die konservativen Instinkte, was in einer Situation ohne klare Zukunftsperspektive Anklang findet.
Die real vorhandenen Spaltungen (Löhne, Arbeitsbedingungen, usw.) und die weitverbreitete politische Desorientierung unter den Lohnabhängigen bilden einen wesentlichen Nährboden für den Rechtspopulismus.
Die Situation in den USA
In den USA gibt es eine Besonderheit. Denn mit den Republikanern hat sich eine der historischen Parteien, die es schon seit langem gibt und die auch schon x-mal den Präsidenten gestellt hat, zu einer rechtspopulistischen Partei transformiert. Nach dieser Transformation sind die Republikaner jetzt eine andere Partei als etwa noch unter George W. Bush. Sie sind aber nach wie vor die einzige konservative/rechte Partei, die realistische Aussichten auf Erfolg bei Wahlen hat. Das liegt hauptsächlich am konsequenten Mehrheitswahlrecht der USA, das die Etablierung von Neugründungen sehr schwer macht und die Herausbildung von zwei großen, breit aufgestellten Parteien fast erzwingt. Die Wähler in den USA können deshalb nicht zwischen einer herkömmlichen konservativen Partei und einer rechtspopulistischen Partei auswählen, wie das etwa in Deutschland zwischen CDU/CSU und AfD möglich ist.
Mit Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump stellen die rechtspopulistisch gewendeten Republikaner den Präsidenten und sie haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Sie sind also an der Macht. Und das nicht in irgendeinem Land, sondern in der Weltmacht USA, mit dem daraus folgenden politischen Einfluss und Gewicht. Trump und seine Republikaner haben einen viel größeren Spielraum als etwa eine europäische rechtspopulistische Regierung (Orban, Meloni). Die Geschehnisse in den USA bleiben keineswegs auf das Land beschränkt, sie haben immer auch eine erhebliche weltpolitische Dimension.
Die Rechtsentwicklung der Republikaner
Die Parteien in den USA sind und waren schon immer sehr breite Bündnisse mit der Hauptaufgabe, Kandidaten für die Wahlen aufzustellen. Früher gab es bei den Demokraten und Republikanern große Überschneidungen in der politischen Ausrichtung. Konservative Demokraten (besonders aus den Südstaaten) standen z.B. oft weit rechts von Vertretern des liberalen Flügels der Republikaner (die hauptsächlich aus den Neu-England Staaten kamen). Allerdings war bereits seit den 1960er Jahren ein Prozess zu beobachten, der diese Überschneidungen immer kleiner und die Unterschiede größer und markanter werden ließ. Die konservativen (wenn nicht rassistischen) Südstaatler verließen nach und nach die Demokratische Partei. Der bekannteste Vertreter dieses Typs ist vielleicht George Wallace, der im Zeitraum von 1963 bis 1987 insgesamt viermal Gouverneur von Alabama war und auch mehrere Versuche unternommen hat, Präsident zu werden, zuerst innerhalb und später dann, als Unabhängiger, außerhalb der Demokratischen Partei. Parallel zur Abwendung der Südstaatler von der Demokratischen Partei wurden die Republikaner nach und nach das Sammelbecken für den rechten politischen Rand. Liberale Positionen wurden dagegen immer seltener.
Einen weiteren Schub nach rechts bedeutete ab 2009 das Aufkommen der sogenannten „Tea-Party-Bewegung“. Diese war geprägt durch die für die USA typische Stärke der religiösen Rechten, zweitens durch Gruppen, deren Weltbild durch eine erheblichen Reserviertheit, manchmal fast durchgängige Ablehnung gegenüber dem Zentralstaat bestimmt ist (Limited-Government-Conservatism). Diese gegen „Big-Government“ gerichtete Strömung hat in den USA eine lange Tradition und ist ein wesentlicher Bestandteil des dortigen Konservatismus. Im Gegensatz zu Europa, wo konservative Kreise vielmehr auf einen starken Staat ausgerichtet sind.
Mit der „Tea-Party-Bewegung“ wurde auch die Kritik von rechts an den „Eliten“ in Staat und Wirtschaft in größerem Ausmaß politisch wirksam. Eliten, die von den „normalen“, durchschnittlichen Amerikanern abgekoppelt seien. Man darf dabei nicht vergessen, dass die „Tea-Party-Bewegung“ auch eine Folge der Finanzkrise von 2008 war. Sie war eine Art Protest gegen die Rettung der „Großen“ (Banken, Versicherungen, etc.) durch staatliche Eingriffe, während die „Kleinen“ (z.B. Hauskäufer, die ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten) mit ihren Problemen allein gelassen wurden.
Mit dem Einstieg von Donald Trump in den innerparteilichen Wahlkampf (2015) um die Präsidentschaftskandidatur beginnt eine weitere Phase der Rechtsentwicklung. Trump startete als Außenseiter, der zuerst von vielen nicht als ernsthafter Bewerber eingeschätzt wurde. Im Verlauf der Vorwahlen zeigte sich aber bald, Trump kann trotz oder wahrscheinlich gerade wegen seines unkonventionellen Politikstils sehr gut Wähler mobilisieren. Auch Wähler, die bisher keine Anhänger der Republikaner waren, z.B. Wähler aus der Arbeiterklasse oder Leute, die sich früher gar nicht an Wahlen beteiligt hatten. Sicherlich schreckt Trump durch seinen Stil auch manche Wähler ab. Aber der Mobilisierungseffekt überwog deutlich.
Durch seine Erfolge als Wahlkämpfer und durch seine Offenheit gegenüber den verschiedenen rechten bis ultrarechten Strömungen konnte sich Trump als Anführer der populistischen Rechten etablieren. Sein Slogan „ Make America Great Again“ = MAGA wurde zum Markenzeichen für dieses Lager, das die rechtspopulistische Transformation der Republikanischen Partei vorantrieb. Durch den Sieg bei den Vorwahlen und den Erfolg bei der Präsidentschaftswahl im November 2016 wurde Trump zum Anführer der gesamten Republikanischen Partei. Auch traditionelle Republikaner, die eigentlich noch Vorbehalte gegen seine Person und/oder bestimmte inhaltliche Positionen hatten, reihten sich aus opportunistischen Gründen unter seiner Führung ein.
Das Kalkül ist klar: durch ein Zusammenwirken im Bündnis Republikanische Partei wollen alle innerparteilichen Fraktionen an der Macht teilhaben, die durch einen Wahlsieg errungen werden kann. Sie erwarten, dadurch auch ihre jeweils eigenen, speziellen Interessen vorantreiben zu können. Nicht unbedingt immer in idealer Weise - Zugeständnisse und Kompromisse sind in diesem Geschäft unvermeidlich -, aber doch besser und weitgehender, als sie es von jeder anderen Konstellation erwarten können. Trump gilt als Garant für Wahlerfolge und als durchsetzungsfähig, der liefert, was er versprochen hat.
Traditionell waren und sind die Republikaner auch die Vertreter von Big Business, insbesondere der sogenannten alten Industrien, wie Stahl, Kohle, Erdöl, während die Vertreter der neuen Technologien in der Vergangenheit eher den Demokraten zuneigten. Bekanntlich sind die Größen der Tech-Branche nach dem zweiten Wahlsieg von Trump reihenweise umgeschwenkt. Ob das nur aus opportunistischen Gründen erfolgte, um sich die neue Regierung nicht zum Gegner zu machen, oder eine dauerhafte Umorientierung darstellt, muss sich zeigen.
Durch das Erstarken der MAGA-Rechtspopulisten ist die Partei erheblich nach rechts gerückt. Aber die Partei ist deshalb nicht homogener geworden. In gewisser Weise ist sie jetzt noch vielfältiger. Denn auch im MAGA-Lager selbst gibt es inhaltlich eine erhebliche Heterogenität. Dazu hat sich eine schillernde Schar von unkonventionellen ideologischen Strömungen bei den Republikanern versammelt. Selbstverständlich gibt es die alten konservativen Unterstützer (Evangelikale, Waffenlobby, sonstige Interessenvertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft) auch noch. Das ist unter anderem ein Grund für die Wahlerfolge. Der alte traditionelle Anhang stimmt in seiner Mehrheit weiterhin für die Partei.
Zu Beginn der ersten Amtszeit Trumps war der Einfluss der MAGA-Leute noch vergleichsweise gering und unorganisiert. Das hat sich im Verlauf der Zeit geändert. Die MAGA-Strömung wurde immer einflussreicher und insofern dominierend, als sie meistens in der Lage war und ist, unliebsame innerparteiliche Bewerber durch den Mechanismus der Vorwahlen zu disziplinieren oder zu Fall zu bringen. Bei den Vorwahlen ist die Wahlbeteiligung oft gering und die MAGA-Anhänger sind aktivistischer und besser mobilisierbar als die Sympathisanten der anderen innerparteilichen Richtungen. Das MAGA-Lager bildet sozusagen die Mehrheit innerhalb der Mehrheit. Durch ihren dominierenden Einfluss innerhalb der Republikaner können sie nach einem Wahlsieg auch deren Regierungspolitik entscheidend beeinflussen.
Wegen der innerparteilichen Heterogenität (von Vertretern der traditionellen Linie bis hin zur extremistischen Rechten) ergibt sich für die politische Führung die Notwendigkeit, alle unterschiedlichen Strömungen und Auffassungen irgendwie unter einen Hut zu bringen und viele verschiedene Interessen zu bedienen. Gemäß dem amerikanischen Regierungssystem spielt der Präsident bei der konkreten Ausgestaltung der Politik die wichtigste Rolle. Fraglich ist, wie Trump als Person diese Rolle des Schiedsrichters und letzten Entscheiders ausfüllt. Vermutlich geschieht das nicht besonders systematisch und keineswegs immer wirklich durchdacht. Trump ist mit Sicherheit kein Ideologe, dem es ein großes Anliegen ist, eine einheitliche Linie in der Partei durchzusetzen. Er setzt mehr auf die Methode, möglichst vielen etwas zu bieten und diese vielen in einem lockeren Bündnis, das er anführt, zu versammeln. Er scheut sich nicht, in Wahlkämpfen so ziemlich allen alles zu versprechen, ohne sich um die damit verbundenen Widersprüche zu kümmern. Man muss deshalb davon ausgehen, dass bei den Fragen, die innerhalb der Partei und auch innerhalb der MAGA-Gruppe strittig sind, die konkret verfolgte Politik von Mal zu Mal ausgehandelt und festgelegt wird und unter Umständen nach relativ kurzer Zeit auch wieder revidiert werden kann.
Anscheinend kommt es im politische Alltag darauf an, welcher Berater aus dem engeren Machtzirkel gerade das Ohr des Präsidenten hat. Einfluss und Gewicht der verschiedenen Strömungen können sich anscheinend relativ schnell ändern. Aber Trump ist nun mal der Anführer der MAGA-Bewegung und der aller Republikaner geworden, mit allen seinen persönlichen Eigenheiten. Entscheidend dafür waren seine Qualitäten als Wahlkämpfer, als jemand, der ständige Aufmerksamkeit und Präsenz in den Medien garantiert. Ausgefeilte Konzepte oder eine durchdachte politische Strategie für komplexe Probleme spielten dabei keine Rolle. In seiner Grandiosität, von der er anscheinend selbst fest überzeugt ist, geht er davon aus, für alles, was er anpackt, leicht und schnell eine Lösung finden zu können. Es ist gut vorstellbar, dass auch Minister, Berater und sonstige Mitarbeiter mit der Person Trump und seinem Stil des öfteren Probleme haben.
Eine kritische Phase für Trump ergab sich durch sein Verhalten nach der Wahlniederlage von 2020, als er behauptete, die Wahl sei gestohlen, er wäre der wahre Sieger etc. und durch seine Versuche, doch noch etwas an den Wahlergebnissen zu drehen und insbesondere durch den Sturm auf das Kapitol kurz vor der Amtsübergabe 2021, unternommen von seinen radikalen Anhängern.
Es ist bezeichnend für die Situation in den USA, dass daraus letztlich keine politischen Nachteile für Trump entstanden sind. Bei den Republikanern war die Kritik an diesen Vorfällen von Haus aus schwach und brach nach kurzer Zeit zusammen. Die wenigen standhaften Opponenten konnten politisch isoliert und abserviert werden. Den Demokraten ist es nicht gelungen, daraus einen entscheidenden Vorteil zu ziehen. Trump konnte im Folgenden seine Position als wichtigster Politiker der Republikaner nicht nur halten, sondern sogar noch ausbauen. Daran haben auch die juristischen Verfahren, die gegen Trump gelaufen sind, nichts geändert. Die Verurteilung im Schweigegeld-Prozess hat Trump politisch nicht geschadet. Die anderen und eigentlich politisch schwerer wiegenden Anklagen verliefen letztlich im Sande (spätestens nach dem Urteil des Supreme Court zur Straffreiheit bei präsidialen Amtshandlungen).
Wofür steht MAGA inhaltlich ?
Die MAGA-Bewegung konnte in den vier Jahren von Bidens Amtszeit nicht nur ihre Stellung innerhalb der Republikaner festigen, sie konnte auch die Zeit nutzen, eine weitere Präsidentschaft vorzubereiten. Die Vorbereitung wurde, soweit das öffentlich nachvollziehbar ist, durch diverse rechte Think Tanks geleistet. Zu nennen ist vor allem die „Heritage Foundation“ mit dem umfangreichen „Projekt 2025“ (https://www.project2025.org „Mandate for Leadership, The Conservative Promise“ = „Auftrag zur Führung, Das konservative Versprechen“). Auch sonst gibt es noch einige rechte Denkfabriken, die intensive Kontakte zur MAGA-Bewegung pflegen, etwa das „America First Policy Institut“ oder das „Claremont Institut“. An finanziellen Mitteln, um Konzepte und Empfehlungen auszuarbeiten, scheint es nicht zu fehlen.
Liest man, was Protagonisten der MAGA-Bewegung geschrieben haben, findet man in großem Ausmaß Äußerungen, die den oben beschriebenen rechtspopulistischen Vorstellungen entsprechen, also viel Polemik gegen die Wokeness-Kultur, gegen angebliche Klimaextremisten, gegen die liberalen „Fake-News-Medien“, gegen Abtreibung und die dadurch angeblich bewirkte Zerstörung der Familien. Man liest Forderungen zur Schließung der Grenzen, zum Ausbau der Militärmacht und Ausführungen zur herausgehobenen Stellung der amerikanischen Nation (dem sogenannten Amerikanischen Exzeptionalismus).
Aber es gibt auch Themen, zu denen innerhalb des MAGA-Lagers unterschiedliche Auffassungen vertreten werden, und zwar so deutlich unterschiedliche, dass sie nicht miteinander in Einklang zu bringen sind, auch wenn sie alle konservativ, rechts oder reaktionär sind.
Grob lassen sich zwei Grundtendenzen feststellen. Es gibt die eindeutig neoliberalen oder libertären Positionen. Sie propagieren ihre bekannten Forderungen nach Abbau von Regulierungen aller Art, zur Reduzierung des Sozialstaats, nach niedrigen Steuern usw., kurz dem schrankenlos freien Markt und einem schlanken bzw. fast nicht mehr existierenden Staat. Die radikalsten Vorstellungen wenden sich dabei auch von der bürgerlichen Demokratie ab. In ihren Utopien (Free Cities = Freie Privatstädte) gelten die Gesetze des Marktes und die Freiheit, mit seinem Geld machen zu können, was man will, absolut. Es gibt keine gewählten Politiker mehr, nur noch eine Art Geschäftsführer (CEO), der Leitungsfunktionen rein technokratisch ausübt.
Aber es gibt auch andere Richtungen, die sich signifikant von den libertären Ansichten unterscheiden und eher korporatistisch verfasste Gesellschaften propagieren. Für sie sind die Menschen nicht nur Individuen, die allein über Marktbeziehungen miteinander in Beziehung treten. Sie beschreiben die Menschen als eingebettet in traditionelle Gemeinschaften, wie etwa Familien, als Arbeitende und als Produzenten des Wohlstands, die innerhalb einer geordneten Welt leben wollen und sollen. Die für eine so geordnete Welt gedachten Wunsch-Gesellschaftsordnungen sind definitiv nicht egalitär und auch nicht unbedingt demokratisch. Sie erkennen aber an, dass die Interessen der arbeitenden Mehrheit irgendwie berücksichtigt werden müssen.
Es wäre deshalb zu stark vereinfacht, die MAGA-Linie nur auf Neoliberalismus und/oder libertäre Vorstellungen zu reduzieren. Es gibt auch ein gerütteltes Maß an rechtem Kommunitarismus oder Korporatismus, der in einer gewissen, wenn auch verdrehten Weise Interessen der „kleinen Leute“, wenn man so will, auch der Arbeiterklasse, zum Ausdruck bringt.
Diese unterschiedlichen Richtungen bei den Politik-Entwürfen finden sich auch noch, ungeachtet ihrer Widersprüchlichkeit, im Wahlprogramm und bei der bisher umgesetzten Politik.
Der Slogan „Make America great again“ ist durchaus ernstzunehmen. Denn das übergeordnete Ziel ist es, die Vormachtstellung der USA zu erhalten und auf den Gebieten, wo sie vielleicht geschwächt wurde, wiederzuerlangen. Dazu sollen möglichst alle Hindernisse beseitigt werden, die Einschränkungen bedeuten würden, sei es ökonomisch oder machtpolitisch. Um die eigenen Machtmittel zu erhalten und auszubauen, ist man bereit, einen beträchtlicher Aufwand zu betreiben. Das zeigt sich deutlich an den von Jahr zu Jahr steigenden Rüstungsausgaben. Kürzungen und Einsparungen beim Militär sind weitgehend tabu.
Prinzipiell ist das nicht wesentlich verschieden von dem, was die vorherigen US-Regierungen angestrebt haben. Die rechtspopulistischen MAGA-Leute haben keineswegs die Absicht, die grundsätzliche Ausrichtung der US-Politik total zu verändern. Sie erheben „nur“ den Anspruch, die aus ihrer Sicht bisher begangenen Fehler und Versäumnisse auszumerzen und die Interessen der USA besser und gründlicher voranzubringen als alle anderen vor ihnen. Sie kritisieren, dass eine Abschwächung der US-Vormachtstellung bereits zugelassen worden wäre, dass man gegenüber anderen Ländern oft viel zu nachgiebig gewesen sei, dass viel Geld im In- und Ausland verschwendet wurde für Programme, die aus ihrer Sicht den wahren Interessen der Amerikaner widersprechen würden, weil sie progressiv, woke oder links waren.
Die MAGA-Linie ist bereit, radikaler und rücksichtsloser (auch in Bezug auf ihre Verbündeten) vorzugehen. Sie ist auch bereit, einige seit langem von den USA eingenommenen Positionen aufzugeben und gewohnte Praktiken zu verändern. Dazu gehören auch einige Punkte von großer Bedeutung für die internationale Politik, wie die durch die Globalisierung entstandene internationale Arbeitsteilung, der Freihandel und die Rolle von Bündnissen wie der NATO. Die dazu in der Vergangenheit verfolgte Politik ist jetzt nicht mehr selbstverständlich. Die MAGA-Richtung setzt sich damit nicht nur von den Demokraten ab, sondern sie verlässt auch eine Linie, die über Jahrzehnte einen Grundkonsens der US-amerikanischen Politik bildete. Einen Grundkonsens, der auch von den republikanischen Präsidenten und Regierungen vertreten wurde. Die MAGA-Politik kombiniert Kontinuität beim übergeordneten Ziel - Erhalt der US-Hegemonie - mit der, allerdings einschneidenden, Modifikation einiger Aspekte der konkreten Politik.
Diese Modifikationen können für direkt Betroffenen erhebliche Folgen haben. Die Aufregung, die Trump in den hiesigen Medien auslöst, ist zum großen Teil dadurch begründet, dass auch Bereiche zur Disposition gestellt wurden, die für die europäischen Verbündeten von zentraler Bedeutung sind wie die NATO, das Verhältnis zu Russland und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den USA.
Allerdings scheint manchmal innerhalb der Administration und der Republikanischen Partei noch nicht endgültig geklärt zu sein, wie radikal die Kurskorrekturen genau ausfallen sollen und werden. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Einschätzung des Krieges in der Ukraine und, damit zusammenhängend, des Verhältnisses zu Russland. Die bestehende unterschiedliche interne Beurteilung des Themas ist dokumentiert. Im „Projekt 2025“ (Seite 181 ff.) werden die abweichenden Positionen folgendermaßen benannt:
„Ein Punkt, der heute die Konservativen stark entzweit, ist der Russland-Ukraine Konflikt.“ … „Eine Denkschule der Konservativen hält fest, solange Moskaus rechtswidriger Aggressionskrieg gegen die Ukraine anhält, stellt Russland eine große Herausforderung für die US-Interessen dar, genauso wie für Frieden, Stabilität und die Sicherheitsordnung nach dem Kalten Krieg in Europa.“ ...
„Eine andere konservative Denkschule streitet ab, dass die US-Unterstützung für die Ukraine generell im Interesse der nationalen Sicherheit Amerikas ist.“ … „Die durch den Konflikt direkt betroffenen europäischen Länder könnten die Ukraine bei der Verteidigung unterstützen, aber die Vereinigten Staaten sollten ihre Beteiligung [an der Unterstützung] nicht fortsetzen.“
Die erste Position wurde in den letzten Jahren von der Mehrheit der republikanischen Parlamentarier (Senat und Repräsentantenhaus) eingenommen, die MAGA-Anhänger im engeren Sinne vertraten die zweite Position und lehnten Unterstützung für die Ukraine meistens ab. Im „Projekt 2025“ folgt auf die kurze Darstellung der unterschiedlichen Positionen keine intensive Diskussion mit dem jeweiligen Für und Wider zu den Auffassungen der beiden Denkschulen und es folgt auch keine Empfehlung. Es wird nur angemerkt, dass es jetzt die Aufgabe des Präsidenten sei, das weitere Vorgehen festzulegen.
Ein unentschiedenes Sowohl-Als-Auch findet sich im „Projekt 2025“ auch beim Themenpaar Freihandel versus Zölle. Peter Navarro plädiert in seinem Beitrag (Seite 765 – 795) für eine starke Anhebung der Zolltarife, Kent Lassmann für Freihandel (Seite 796 – 823).
Die umgesetzte Politik
Trump ist offensichtlich gut vorbereitet in die zweite Amtszeit gegangen. Das wurde bereits in den ersten Tagen nach dem 20. Januar durch die schnelle Folge der Maßnahmen sichtbar.
Einmal ist zu nennen die reibungslose Besetzung von Schlüsselpositionen. Für alle wichtigen Positionen (Minister, Sicherheitsberater etc.) wurden ausschließlich Personen vorgeschlagen, die als unbedingt loyal gegenüber Trump und seinem Kurs gelten. Ihre fachliche Kompetenz war offensichtlich weniger wichtig. Bis auf eine Ausnahme (Matt Gaetz, dem Kandidaten für das Justizministerium, dem sexuelle Verfehlungen vorgeworfen wurden) wurden sie auch vom Senat bestätigt.
Zweitens wurden mit Beginn der Amtseinführung eine sehr große Anzahl an präsidialen Verfügungen (Executive Orders) unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt. Diese waren von langer Hand vorbereitet. Im „Projekt 2025“ wird die Vorgehensweise genau beschrieben. Ministerium für Ministerium und Behörde für Behörde wird durchgegangen. Es werden genaue Vorstellungen davon entwickelt, wo jeweils (personelle) Veränderungen notwendig sind bzw. wie sonst eingegriffen werden sollte.
Das bisherige Regierungshandeln mit der Vielzahl von Dekreten läuft genau in diese Richtung. Die Praxis entspricht also dem Drehbuch. Sie ist der Ausdruck der von führenden MAGA-Leuten (z.B. Russel Vought) vertretenen sogenannten „Unitary Executive Theory“ (Theorie der einheitlichen Exekutive), die postuliert, der Präsident hätte mit fast unbegrenzten Vollmachten die alleinige Autorität über die Exekutive. Was gerade in den USA abläuft, ist kein normaler Regierungswechsel, es ist eine Art Machtergreifung.
Viele dieser Verfügungen sind juristisch umstritten und könnten verfassungswidrig sein. Inzwischen gibt es etliche Klagen vor Gericht und bereits auch Urteile gegen die Regierung. Wie weit das Vorgehen der Exekutive durch die Gerichte begrenzt oder gar gestoppt werden wird, muss sich noch zeigen. Letztlich wird viel von den Entscheidungen des obersten Gerichts abhängen, bei dem die wichtigen juristischen Kontroversen früher oder später landen werden. Bei einem obersten Gericht allerdings, in dem bekanntlich während der ersten Regierungszeit Trumps eine konservative, rechte Mehrheit etabliert werden konnte.
Es geht um die Ergreifung der Macht und um deren Zementierung. Damit ist wahrscheinlich das erste und wichtigste Ziel der MAGA-Bewegung gut beschrieben. Oder anders ausgedrückt, jeder liberale oder gar linke Einfluss (links ist dabei im weitesten Sinne zu verstehen) soll aus allen wichtigen Positionen verdrängt werden.
Weitere Aktivitäten hängen unmittelbar mit diesen Ziel zusammen. Durch mehrere Dekrete wurde ein heftiger Kulturkampf eingeleitet. Hauptangriffspunkt sind die sogenannten DEI-Programme (die Abkürzung DEI steht für diversity, equity, inclusion = Diversität, Gerechtigkeit, Inklusion), die unter Biden vielfach eingeführt wurden. Im staatlichen Bereich sind solche Programme jetzt verboten, im privaten Bereich bei Firmen, Anwaltskanzleien etc. werden sie indirekt mit ausgeübtem Druck (Entzug von Aufträgen) bekämpft. Auch alles, was mit „Critical Race Theory“, „Postcolonial Studies“ oder „Gender Studies“ zu tun hat, steht auf der Abschussliste.
Eine Variante des Kulturkampfes ist das Vorgehen gegen (private) Universitäten. Für die Rechten sind Universitäten ein verhasstes Feindbild. Sie sehen in ihnen Zentren des Widerstands, Hochburgen für Wokeness und linke Gesinnung. Angeblich geht es darum, dort vorhandenen Antisemitismus zu unterbinden. Das eigentliche Ziel ist es, die weitgehend sich selbst verwaltenden Universitäten einer strikteren Kontrolle zu unterwerfen. Dazu wird massiver finanzieller Druck ausgeübt, vor allem durch die Sperrung von staatlichen Forschungsgeldern auch für viele Projekte, die in keiner Weise „woke“ oder politisch sind.
Weitere priorisierte Aktivitäten waren und sind:
Der Stopp der Einwanderung. Die Grenze zu Mexiko wurde für Menschen ohne gültige Einreisepapiere geschlossen. Auch durch den Einsatz des Militärs, der durch den Ausruf eines Notstands an der Grenze juristisch möglich wurde (was verfassungsrechtlich umstritten ist). Dadurch wird bis jetzt ein relevanter Neuzugang verhindert. Dazu kommen spektakuläre Abschiebungen, die als Medienereignis inszeniert werden und als Erfolgsausweis für das breite Publikum dienen sollen.
Aber anscheinend erfolgt keine substanzielle Reduzierung der „Illegalen“, die bereits im Lande sind, einen Job haben, einigermaßen integriert sind. D.h. im Wesentlichen werden die Interessen derer, die diese (günstigen) migrantischen Arbeitskräfte ohne Papiere (für die Landwirtschaft oder als Haushaltshilfen) nachfragen, nicht wirklich angetastet.
Für das Ziel, den Staat effizienter zu machen, wurde eigens die neue Behörde DOGE (Department of Government Efficiency) geschaffen. Im Vorfeld wurden phantastische Sparziele genannt, die eine Wende bei der ständig steigenden Staatsverschuldung bringen sollten. Von bis zu zwei Billionen Dollar war die Rede (das wären ca. 30% des Haushalts gewesen), die angeblich durch das Wirken von DOGE eingespart werden könnten. Unter der Leitung von Elon Musk ging DOGE heftig ans Werk. Radikal wurden ganze Behörden aufgelöst, Mitarbeiter entlassen, Geldflüsse gestoppt. Viele Maßnahmen sind rechtlich äußerst fragwürdig und wurden vor Gericht angefochten. (Es gibt bereits mehreren Niederlagen für die Regierung in den ersten Instanzen).
Ende Mai hat Elon Musk seine aktive Tätigkeit für die Regierung wieder beendet. Er selbst gibt an, durch DOGE Einsparungen von 175 Milliarden Dollar bewirkt zu haben. Diese Zahl wird aber von vielen als stark übertrieben eingeschätzt. Die NGO „Partnership for Public Service“ geht davon aus, dass, wenn man die durch Gerichte erzwungenen Rückabwicklungen und ähnliche Effekte berücksichtigt, die überhasteten Sparmaßnahmen sogar Mehrkosten von 135 Milliarden Dollar verursacht haben könnten.
Es überwiegen also rein destruktive und zerstörerische Effekte. Vermutlich ist das Zerstören von staatlichen Stellen, bei denen linker Einfluss und der „tiefe Staat“ vermutet wurden, auch ein primäres Ziel der Aktionen gewesen. Besonders USAID, eine der hauptsächlich betroffenen Institutionen, wurde sehr oft beschuldigt, eine (angeblich) linke Agenda zu verfolgen.
Laut den Berichten verschiedener Medien gab es anscheinend von Seiten Trumps gegenüber Vertretern des Kapitals Zusagen für weitgehende Deregulierungen auf verschiedenen Gebieten (auch unabhängig von den DOGE-Aktivitäten). Diese Zusagen könnten für dieses Klientel der Grund sein, bei anderen Punkten (z.B. Freihandel und Zöllen) mit Kritik (vorläufig) zurückhaltend zu sein.
Im Wahlkampf wurden große Steuersenkungen bei den Gewinn- und Einkommenssteuern versprochen (für Trump sind es natürlich die größten Steuersenkungen, die es je gab). Das genaue Ausmaß und die (eventuelle) Gegenfinanzierung ist noch offen. Ein Teil der geplanten Steuersenkungen ist momentan Gegenstand der Haushaltsberatungen im Kongress. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Verlängerung und um den Ausbau der in der ersten Amtszeit beschlossenen Maßnahmen. Damals wurden einige Steuersenkungen mit einer zeitlichen Begrenzung versehen. Deshalb müssen sie jetzt verlängert werden. Das Haushaltspaket wurde am 22. Mai 2025 mit der denkbar knappen Mehrheit von 215 zu 214 Stimmen im Repräsentantenhaus verabschiedet. Die Zustimmung des Senats steht noch aus.
Das wichtigste außenpolitische Ziel ist erklärtermaßen, das aufstrebende China einzudämmen und möglichst klein zu halten. Das ist nicht neu und wird im Prinzip auch von den Demokraten mitgetragen. Dazu sollen, wie in der Vergangenheit, Handelsbeschränkungen und (extrem) hohe Zölle dienen. Welche Mittel sonst noch zum Einsatz kommen könnten, ist weit weniger klar.
Prinzipiell scheint die Auffassung zu bestehen, die USA könnten so ziemlich alle internationalen Konflikte in ihrem Sinne regeln, wenn sie, ausgehend von einer Position der Stärke, heftige und wüste Drohungen (wirtschaftlich, militärisch) mit der Möglichkeit, „Deals“ auszuhandeln, kombinieren. Man kann sich fragen, ob das wirklich realistisch ist. Aber das soll hier nicht ausführlich diskutiert werden.
Gemäß der Parole „America first“ wird der eigene Vorteil mit brutaler Offensichtlichkeit in den Vordergrund gestellt. Alle Kosten und Lasten sollen soweit wie nur möglich auf andere verlagert werden. Dazu werden die militärische Stärke und das Potenzial der weltweit größten Volkswirtschaft in erpresserischer Weise ausgenützt.
Wenn einmal die Rede war von Amerika als wohlwollendem Hegemon, ist es spätestens jetzt mit dem Wohlwollen und der Freundlichkeit vorbei. Wer etwas von den USA will, muss dafür bezahlen oder andere Gegenleistungen erbringen, die ziemlich willkürlich und einseitig, versehen mit abenteuerlichen Begründungen, festgelegt werden, unabhängig davon, ob die andere Seite bisher Verbündeter oder Rivale war.
Nach innen wird die Vorgehensweise als Reaktion auf jahrelange Übervorteilung und Betrug durch das Ausland gerechtfertigt. Dabei gerät in den Hintergrund, dass die bestehenden Bündnissysteme genauso wie die Wirtschaftsordnung in weiten Bereichen ziemlich genau das sind, was die USA jahrzehntelang angestrebt und auch gegen Widerstand durchgesetzt haben.
Auch ein erheblicher Teil der Lohnabhängigen hat für Trump bzw. für die Republikaner gestimmt. Das ist eine der wesentlichen politischen Verschiebungen der letzten Jahre. Trump gelang es, sich als Vertreter der „kleinen Leute“ zu inszenieren, als Kritiker der Eliten und des korrupten Politik-Establishments in Washington, auch wenn er selbst ebenso wie auch ein großer Teil seines Kabinetts eindeutig und offensichtlich dem Establishment entstammen. Nie gab es so viele Milliardäre in einer Regierung wie jetzt unter Trump.
Das Vorgehen gegen die Zuwanderung und die Anti-DEI-Kampagne wird sicher bei manchen Arbeitern auf mehr oder weniger große Zustimmung stoßen.
Im Programm von Trump gibt es nicht viele Punkte, die spezifisch die Interessen der Lohnabhängigen ansprechen. Es gibt das allgemeine Versprechen, für stabile Preise zu sorgen und das noch viel allgemeinere von den Goldenen Zeiten, die kommen werden.
Konkreter ist die Aussage, die zentralen Sozialleistungen, Social Security (Renten) und Medicare (medizinische Versorgung für über 65-jährige), nicht anzutasten, was aber über den Erhalt des Status quo nicht hinausgeht.
Und dann gibt es noch das Ziel der Stärkung der heimischen Industrie, das viele neue und gut bezahlte Arbeitsplätze bringen soll. Die Rede von der Reindustrialisierung spielt in der Trump'schen Propaganda eine wichtige Rolle. (Diese und andere ökonomische Fragen werden erst in der nächsten Nummer der Arbeiterstimme behandelt.)
Resümee
Seit dem Beginn der zweiten Amtszeit Donald Trumps üben rechtspopulistische Kräfte bestimmenden Einfluss auf die US-Politik aus. Grundsätzlich bleibt auch unter dieser Konstellation das Ziel bestehen, die Hegemonie der USA zu erhalten und zu stärken. Allerdings mit einigen nicht unwesentlichen Veränderungen im Vergleich zur bisherigen Politik.
Das betrifft die Zollpolitik (und damit einen wesentlichen Teil der Wirtschaftspolitik), aber auch andere Themen. Zu nennen sind etwa die Bündnispolitik im Bezug zur NATO, das Verhältnis zu Russland, Klimawandel und Umwelt und insbesondere auch die Innenpolitik mit dem Versuch, die Macht der Exekutive entscheidend auszudehnen.
Allerdings bleibt es teilweise im Ungewissen, wie konsequent diese neuen Ansätze durchgezogen werden, oder ob nicht doch noch Rückzieher erfolgen und als Ergebnisse letztlich Kompromisse herauskommen, die deutlich weniger dramatisch sein könnten als die ursprünglichen Ankündigungen.
Im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene Gründe, die diese Ungewissheit erklären können. Einmal die noch nicht geklärten Richtungsentscheidungen innerhalb der Republikanischen Partei bzw. der MAGA-Bewegung oder zweitens der für die Person Trump typische Politikstil mit einer Kombination aus radikalen Ankündigungen und der Möglichkeit, „Deals“ mit von den Ankündigungen abweichenden Inhalten auszuhandeln. Selbstverständlich schließen sich die beiden Gründe nicht gegenseitig aus.
Aus den USA kam jetzt mehrmals von prominenter Stelle Zuspruch und Unterstützung für die AfD. Was ist davon zu halten? Ist ein Zusammenwirken von Trump, Orban, Meloni und Weidel denkbar? Können sich diese Personen und politischen Kräfte gegenseitig unterstützen und stabilisieren, oder stehen sie sich eher im Wege? Können sie unter Umständen als Alternative zu Merz, Macron und Starmer auftreten? Über diese Fragen muss ernsthaft nachgedacht werden.
Ein Zusammenwirken explizit als Rechtspopulisten (und nicht als westliche Bündnispartner im herkömmlichen Sinn) ist gut möglich, soweit es sich punktuell für oder gegen etwas richtet, was alle Rechtspopulisten befürworten oder ablehnen.
Eine generelle Kooperation könnte durch die jeweiligen Nationalismen eingeschränkt sein. Nationalismus ist zwar eine Gemeinsamkeit aller Rechtspopulisten, aber eine Gemeinsamkeit, die Differenzen produziert. Solange es nicht nur um die Pflege von nationalen Traditionen geht, also eine Art von Folklore, sondern um die Durchsetzung wichtiger Interessen gegen die Interessen von anderen Nationen, muss ein dominanter Nationalismus zwangsläufig auch zu Konflikten führen. Gegenwärtig beanspruchen die USA unter Trump nicht nur eine Führungsrolle für sich, sondern gehen grundsätzlich von der Dominanz der eigenen Interessen aus.
Die Auswirkungen der Präsidentschaft Trump auf die weitere Entwicklung des Rechtspopulismus in Europa sind noch völlig offen. Das amerikanische Beispiel könnte über einen Gewöhnungseffekt die weitere Relativierung von Brandmauern bewirken. Auch eine direkte und indirekte Unterstützung einschlägiger Parteien oder Regierungen ist denkbar. Möglich sind allerdings auch gegenteilige Effekte. Die reale Politik in den USA, das auf das amerikanische Publikum ausgelegte Agieren von Trump und insbesondere US-Maßnahmen, die in anderen Ländern als wenig freundlich wahrgenommen werden, könnten auch eine abschreckende Wirkung entfalten.
Aufgrund der Häufigkeit, mit der es geschieht, muss man den Griff zu rechtsstaatlich fragwürdigen Mitteln als Charakteristikum der Trump'schen Politik ansehen. Dazu passt auch, dass die Regierung versucht, für sie negative Gerichtsentscheide zu ignorieren. Das begründet ernsthafte Befürchtungen bezüglich einer dauerhaften Beschädigung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die MAGA-Bewegung gibt sich zwar als Hüterin der US-Verfassung und als Verteidigerin der dort verbrieften Freiheiten. Aber es gibt in diesen Kreisen auch eine sehr einseitige Interpretation dieser Freiheiten. Die Ereignisse im Januar 2020 zeigen zudem, dass unter bestimmten Umständen, sozusagen bei Bedarf, auch schwere Verstöße gegen die Spielregeln der Demokratie nicht auszuschließen sind.
Die Transformation der Republikanischen Partei zu einer rechtspopulistischen hat sich über einen Zeitraum von bisher etwa zehn Jahren vollzogen. Noch ist unklar, ob diese Entwicklung schon zum Abschluss gekommen ist oder ob in der Zukunft ein weiteres Fortschreiten in diese Richtung, eventuell verknüpft mit einer zusätzlichen Radikalisierung, zu erwarten ist. Ideologisches Potenzial wäre dafür vorhanden.
(Stand: 03.06.2025)
Rechte Theoretiker und Protagonisten
Donald Trump ist geradezu das Gegenteil eines Theoretikers. Zu Recht wird immer wieder festgestellt, dass er anscheinend viele seiner Handlungen aus einem Bauchgefühl heraus unternimmt. Das Chaos ist sein System und die dadurch ausgelöste Verwirrung und Verunsicherung gehören zu seiner Methode.
Das heißt aber nicht, dass es keine Theoretiker gäbe, die Konzepte entwickeln, die gelesen und diskutiert werden und vermutlich auch die praktische Politik beeinflussen. Die meisten dieser Leute galten vor einigen Jahren noch als ziemlich exotisch und wurden wenig beachtet. Jetzt ziehen sie immer mehr Aufmerksamkeit auf sich.
Zu nennen sind:
Patrick J. Deneen
Deneen ist Professor für politische Theorie an der (katholischen) „University of Notre Dame“ in Indiana. Deneen hat zwei Bücher geschrieben, die einen größeren Bekanntheitsgrad aufweisen und teilweise auch auf Deutsch erhältlich sind. „Warum der Liberalismus gescheitert ist“ (2018) und „Regime Change: Toward a Postliberal Future“ (2023). Darin kritisiert er den Liberalismus und den in seinen Augen damit verbundenen exzessiven Individualismus. Die Menschen würden sich nach gemeinsamen Werten und Zugehörigkeit sehnen. Er vertritt einen katholischen Kommunitarismus und bezieht sich zur Begründung gerne auf die mittelalterliche katholische Philosophie (z.B. auf Thomas von Aquin). Deneen ist in den konservativen/rechten Kreisen gut vernetzt, sieht sich selbst aber als Akademiker und nicht als Politiker.
Oren Cass
ist Ökonom und arbeitet als politischer Berater und Publizist. Er fordert und verteidigt ausdrücklich hohe Zölle, da der Freihandel den Nachteil habe, die industrielle Basis eines Landes zu vernichten. Weil die Konsumenten sich von niedrigen Preisen leiten ließen und nicht von der nationalen Sicherheit, müsse man sie von der Sucht nach günstigen, aber importierten Waren befreien.
In der konservativen Szene fällt Cass auf, weil er sich eingehend mit der produktiven Arbeit und den Arbeitern beschäftigt hat. Er hat auch schon für höhere Löhne und ein Bündnis mit den Gewerkschaften plädiert. Dabei vertritt er sozial-konservative Werte und spricht sich für die Kooperation von Arbeiterschaft und Unternehmern aus.
Curtis Yarvin
ist hauptsächlich als Blogger aktiv. Er hat seine Gedanken, die er dort verbreitet, selbst als „neoreaktionär“ oder als „dunkle Aufklärung“ bezeichnet. Der bisherigen (liberalen) amerikanischen Elite unterstellt er, das Land durch Indoktrination und den „Deep State“ zu bedrohen. Er tritt für einen radikal verkleinerten Staatsapparat ein, mit einem absolutistischen CEO an der Spitze.
Bei all diesen Autoren lässt sich eine Verbindung zur MAGA-Bewegung oder zu führenden Personen aus dem Umfeld Trumps belegen. Was aber nicht heißt, dass ein unmittelbarer Einfluss auf die gegenwärtige US-amerikanische Regierung besteht.
Besonders Vizepräsident J.D. Vance scheint die Kontakte zu Denkfabriken und in deren Umfeld zu pflegen. Er tritt bei rechts-konservativen Konferenzen auf und veröffentlicht gelegentlich in einschlägigen Publikationen eigene Beiträge. Er scheint in der Szene gut vernetzt zu sein und ist mit vielen Protagonisten persönlich bekannt.
Peter Thiel
ist kein Theoretiker und auch organisatorisch nicht in Regierung oder Partei eingebunden. Der Milliardär Thiel ist aber ein engagierter und aufgrund seiner finanziellen Mittel zahlungskräftiger Förderer von vielen Initiativen und Einzelpersonen. Er selbst ist ein überzeugter Libertärer, der gerne auch besonders radikale Vertreter dieser Richtung unterstützt. Gegen Ende der ersten Amtszeit von Trump äußerte er Kritik und Enttäuschung, weil dieser während seiner Regierungszeit nicht entschieden genug vorgegangen sei. Es gibt kaum bekannte Vertreter der Rechten, denen nicht auch Kontakte zu Thiel nachgesagt werden. Auch Vance hat für Thiel in dessen Investmentfirma gearbeitet und wurde zu Beginn seiner politischen Karriere stark von ihm unterstützt.
Direkt in die Trump-Administration eingebunden sind:
Stephen Miran
Der Ökonom ist seit März ökonomischer Chefberater der Regierung (Vorsitzender des „Council of Economic Advisors“). Vorher hat Miran bei der Investment-Firma „Hudson Bay Capital“ gearbeitet. Bereits im November 2024, also kurz nach der Wahl von Trump, veröffentlichte er einen Beitrag, in dem er seine Vorstellungen skizziert. ( https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf ). Darin plädiert er für hohe Zölle, Reindustrialisierung und einen tieferen Wechselkurs des Dollars. Auf seine Thesen wird im Septemberheft ausführlicher eingegangen.
Stephen Miller
ist zur Zeit stellvertretender Stabschef im Weißen Haus und damit in einer Schlüsselposition, wenn es um den Zugang zum Präsidenten geht. Er war auch schon während der ersten Amtszeit ein enger Berater Trumps. Er gehört damit zu den wenigen Personen, die für lange Zeit zum engsten Umfeld gehören. Er wird beschrieben als jemand, der die Politik Trumps aus tiefer Überzeugung heraus unterstützt. Besonders das harte Vorgehen bei der Migration soll auf seinen Einfluss zurückgehen. Er gilt in diesen Fragen als ausgesprochener Scharfmacher. Es wird ihm auch das Talent nachgesagt, politische Aussagen kurz, eingängig und meistens auch provokativ auf den Punkt bringen zu können.
Russel Vought
ist Direktor des „Office of Management and Budget“, kurz OMB. Das OMB nennt sich zwar nur Office, also Büro, ist aber in Wirklichkeit eine sehr einflussreiche Behörde. Das OMB berichtet dem Weißen Haus über die Aktivitäten der Bundesbehörden und hat eine beratende Funktion zur Bundespolitik, Verwaltung, Gesetzgebung und Haushaltsführung. Das heißt, das OMB kontrolliert und steuert an einer zentralen Stelle in der Administration. Russel Vought dürfte deshalb eine der einflussreichsten Personen sein.
Der Evangelikale Vought gilt als ultrakonservativ und bezeichnet sich selbst als christlich-nationalistisch. Er ist mehr der Typ des Machers im Hintergrund. Vought ist Autor im „Projekt 2025“. Sein Beitrag zeigt ihn als radikalen Vertreter der Theorie der einheitlichen Exekutive (Unitary Executive Theory), die die Exekutive allein in den Händen des Präsidenten sieht und den Einfluss von Kongress und Justiz möglichst klein halten will. Eine unabhängig agierende Verwaltung mit dort vorhandenem Expertenwissen wird grundsätzlich verdächtigt, den präsidialen Willen behindern zu wollen und im Sinne eines „Tiefen Staates“ (deep state) zu verfälschen. Den Widerstand des „Tiefen Staates“ zu brechen und die Verwaltung einer strikten Kontrolle zu unterwerfen, das sieht er als seine Hauptaufgabe.
Wokeness, Programme zur Förderung der Inklusion und „Klimawandel-Fanatiker“ sind für ihn besondere Feindbilder.