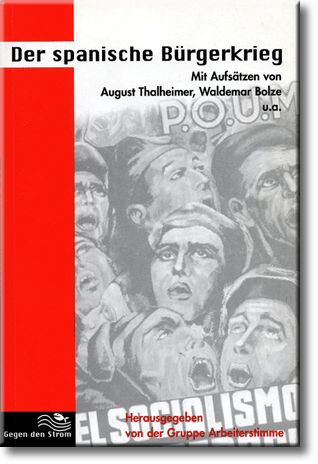Am 28. Juli 2024 haben in Venezuela Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Nach dem amtlichen Ergebnis wurde Nicolas Maduro mit 51,2 % der Stimmen als Präsident wiedergewählt. Die Opposition sieht das ganz anders. Sie reklamierte den Sieg für ihren Kandidaten, Edmundo Gonzales, und spricht von massiven Wahlfälschungen des Regimes. Diese Kontroverse hat Venezuela wieder einen prominenten Platz in den Nachrichten verschafft.
Auch unabhängig von diesem aktuellen Anlass stellt sich die Frage: Wo steht Venezuela heute ? Was ist geblieben von der „bolivarischen Revolution“ und dem Aufbruch in Richtung „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Auch bei uns wurde die Rede vom „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ von vielen Linken zustimmend aufgenommen und Hugo Chavez galt als Hoffnungsträger für Lateinamerika. Es gibt also Potenzial für enttäuschte Hoffnungen und dergleichen. Die hiesige Debatte bildet auch die Motivation, sich mit Venezuela zu beschäftigen. Wir sollten das Thema nicht der anti-sozialistischen Propaganda in dem Sinne, dass „Sozialismus noch nie funktioniert hat, nicht im 20. und auch nicht im 21. Jahrhundert“ - überlassen.
Die Lage in Venezuela ist nicht einfach zu beurteilen. Die meisten hiesigen Medien haben sich eindeutig gegen die dortige Regierung positioniert und berichten deshalb von Haus aus voreingenommen und entsprechend negativ. Zuverlässige Berichte, Informationen und Daten sind Mangelware. Zeitweise hat sogar das Land selbst bzw. seine Institutionen die Publikation von Daten eingestellt. So auch die Zentralbank, die für einige Jahre die international üblichen Daten zu BIP, Inflation usw. nicht mehr veröffentlichte.
Trotz dieser Einschränkungen, deren man sich immer bewusst sein sollte, lässt sich einiges herausarbeiten. Zur Informationsbeschaffung für diesen Artikel wurde häufig die Internetplattform „Amerika21“1 genutzt, die unter anderem auch viele Nachrichten aus Venezuela in deutscher Übersetzung publiziert. Damit hat man Zugang zu unterschiedlichen Stimmen, inklusive von Unterstützern der chavistischen Bewegung und auch zu den Verlautbarungen der Regierung.
Allerdings bleibt die Informationslage trotzdem schwierig. Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die ökonomische Situation, denn zu den wirtschaftlichen Fakten gibt es noch die besten und einigermaßen überprüfbaren Daten.
Dagegen sind mit den gegenwärtig erhältlichen Informationen viele politischen Vorgänge kaum zu durchschauen. Das gilt einmal ziemlich allgemein für alle im Land stattfindenden Diskussionen und politischen Auseinandersetzungen. Noch stärker gilt das für die gegenwärtige Regierung und den PSUV, die die Regierung tragende Partei, mit allen eventuellen internen Richtungsstreitigkeiten bzw. Machtkämpfen. Entsprechende Einschätzungen können deshalb nur sehr zurückhaltend vorgenommen werden. Aus diesem Grund wird dieser Artikel, um es gleich vorwegzunehmen, viele wichtigen Fragen nicht beantworten können, z. B. auch die Frage nach dem tatsächlichen Wahlausgang im Juli.
Zur Vorgeschichte
Venezuela umfasst eine Fläche von etwa 912 000 Quadratkilometer, das ist gut zweieinhalb mal so groß wie Deutschland. Die knapp 32 Millionen Einwohner sind im Land ungleichmäßig verteilt. Die meisten Städte und vor allem die großen Städte liegen auf einem schmalen, bogenförmigen Landstreifen, der sich über das bergige Hinterland der karibischen Küste und die Ausläufer der Anden im Westen von Venezuela erstreckt. Die Lage in den Bergen ist kein Zufall, im tropischen Klima lebt es sich auf einer Höhenlage angenehmer. Der restliche, flächenmäßig wesentlich größere Teil des Landes ist nur dünn besiedelt. Die Landwirtschaft hat traditionell nur geringe Bedeutung und ist wenig entwickelt. Landwirtschaftlich genutzt wird etwa ein Viertel der Fläche, meistens nur extensiv für die Rinderzucht. Typischer Ackerbau spielt eine relativ kleine Rolle.
Wie bei vielen Erdöl produzierenden Ländern ist der Ölsektor auch für Venezuela von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung. Das ist im Prinzip so, seit die Ölförderung im Jahre 1917 begann. Bereits 10 Jahre später war Venezuela der größte Ölexporteur Südamerikas und nach den USA der zweitgrößte Ölproduzent weltweit. Das Ölgeschäft dominierte seitdem die Wirtschaft und generierte den Löwenanteil der Export- und auch der Staatseinnahmen. Der vergleichsweise hohe Mittelzufluss aus dem Ölsektor hatte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur. Es gab genug Devisen, um die Nachfrage mit Importwaren zu decken. Eine Produktion von Gütern für den inländischen Bedarf konnte sich unter den gegebenen Bedingungen kaum entwickeln. Das betraf nicht nur, wie bei vielen anderen Volkswirtschaften der kapitalistischen Peripherie, Investitionsgüter und technisch anspruchsvolle Industrieprodukte, sondern in großem Ausmaß auch Lebensmittel und viele andere, eher einfache Güter des täglichen Bedarfs. Folglich ist die Wirtschaft Venezuelas durch eine starke Importabhängigkeit gekennzeichnet. Solche Wirtschaftsstrukturen sind bei vielen Ländern zu finden, bei denen der Export von Rohstoffen die dominierende Rolle spielt.
Dazu gehört auch die Abhängigkeit von den Schwankungen der Rohstoffpreise, in diesem Fall für Rohöl, auf dem Weltmarkt. Mit dem Auf und Ab der Ölpreise bewegen sich gleichzeitig die Export- und die Staatseinnahmen. In den 1970er Jahren stiegen die Ölpreise mehrmals sprunghaft an (sogenannte 1. und 2. Ölkrise) und erhöhten dementsprechend die Einnahmen Venezuelas. Auch damals gelang es nicht, diese Einnahmen zu nutzen, um die Wirtschaft auf ein breiteres Fundament zu stellen. Als dann die Ölpreise etwa ab 1983 für mehrere Jahre stark fielen, führte das in Venezuela zu heftigen Krisenerscheinungen. Die Auslandsverschuldung stieg stark an, die Inflationsrate kletterte auf über 70 %, es gab eine starke Abwertung des Bolivar. Kapitalflucht, Bankenkrisen und der Staatsbankrott drohten. Es folgte eine Austeritätspolitik nach dem Muster des IWF mit Privatisierungen und Streichung von Subventionen. Die damit verbundene Verschlechterung der Lebensbedingungen löste bei der armen Bevölkerung im Februar 1989 Proteste, Hungerrevolten und Unruhen aus, den sogenannten Caracazo. Der unmittelbare Anlass waren Preiserhöhungen für den öffentlichen Verkehr. Ausgehend von Vororten der Hauptstadt, griffen die Proteste schnell auf die anderen größeren Städte des Landes über. Die die Proteste begleitenden Unruhen waren spontan und unsystematisch, aber heftig. Es kam unter anderem zu Plünderungen von Einkaufszentren. Die damalige Regierung unter dem Präsidenten Carlos Andres Perez ließ diese Aufstände gewaltsam durch den Einsatz von Polizei und Militär niederschlagen. Offiziell gab es dabei 277 Tote. Glaubhafte Schätzungen von unabhängigen Stellen nennen aber viel größere Zahlen. Es ist von 3000 bis zu 5000 Toten die Rede.
Als Spätfolgen dieser Ereignisse sind auch zwei gescheiterte Putschversuche von Teilen des Militärs zu nennen. Einer am 4. Februar 1992 unter der Führung von Hugo Chavez und der zweite am 29. November des gleichen Jahres von Offizieren, die ebenfalls Anhänger von Chavez bzw. des MBR200 waren. (MBR200 = Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, eine von Chavez anlässlich des 200. Geburtstag von Simon Bolivar (1983) gegründete Bewegung). Nach dem Putschversuch wurde Chavez inhaftiert, nach zwei Jahren aber wieder aus dem Gefängnis entlassen. Bei den im Dezember 1998 fälligen Präsidentschaftswahlen trat Hugo Chavez an und wurde mit 56,2% der Stimmen gewählt. Damit begann die Umgestaltung Venezuelas, die „bolivarische Revolution“ oder der „bolivarische Prozess“. Es wurde eine neue Verfassung ausgearbeitet, viele partizipatorischen Initiativen wurden ermutigt und gefördert, Bildungs- und Gesundheitssystem verbessert, eine Reihe von Sozialprogrammen gestartet usw.. 2008 wurde der PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela, Vereinigte sozialistische Partei Venezuelas) durch die Verschmelzung mehrerer Vorgängerorganisationen gegründet. Seitdem stellt der PSUV die Regierung.
Die ökonomischen Basis
Unmittelbar vor und nach 1998 bewegten sich die Rohölpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau (etwas unter 20 $ pro Barrel2). Danach begannen sie zu steigen, erst allmählich, etwa ab 2004 schneller. 2008 lag der Ölpreis bereits bei ca. 95 $ pro Barrel. Darauf folgte im Zuge der Finanzkrise ein Einbruch -2009 waren es nur noch ca. 60 $ -, der aber nur kurz war. 2011 wurden die 100 $ überschritten.
Während der Amtszeiten von Chavez bis zu seinem Tod 2013 (105 $ pro Barrel) ist der Ölpreis stark gestiegen und blieb (fast immer) auf hohem Niveau. Damit sind auch die Staatseinnahmen Venezuelas stark gestiegen und es bestand ein relativ großer finanzieller Spielraum. Dieser Spielraum wurde auch politisch genutzt. In Venezuela wurden viele soziale Verbesserungen umgesetzt. Alle wichtigen sozialen Indikatoren, wie Schulbesuchsquote, Ernährungsniveau und Kindersterblichkeit verbesserten sich. Die Armut wie auch der Ungleichheitsindex konnten deutlich gesenkt werden.
Spätestens 2014 begann die Trendwende. Es folgten Zeiten mit relativ starken Schwankungen des Ölpreises. 2016 und 2020 gab es Tiefpunkte mit nur noch 41 bis 42 $ pro Barrel, vorübergehend auch mal wieder Preise über 100 $, dann wieder Einbrüche. Aktuell (2024) bewegen sich die Preise zwischen 60 und 70 $. Insgesamt ist die Zeit seit 2014 von einem tendenziellen Rückgang der durchschnittlichen Rohölpreise geprägt. Für Venezuela bedeutete das sinkende Einnahmen aus dem Ölexport.
Die sinkenden Ölpreise sind aber nicht alles. Bei Venezuela gab es noch einen weiteren Grund, der zu einem Einbruch bei den Öleinnahmen führte, nämlich der mengenmäßige Rückgang der Ölproduktion. Dieser zweite Grund wog wesentlich schwerer.
In den Jahren von 1998 bis 2015 bewegte sich die Förderung von Rohöl jeweils zwischen 2,6 Millionen und 3,4 Millionen Barrel pro Tag. 2015 wurden im Durchschnitt noch 2,8 Millionen pro Tag gefördert. Danach sank die Ölförderung von Jahr zu Jahr mengenmäßig in erheblichem Ausmaß. 2020 waren es nur noch 680 000 Barrel pro Tag, also nicht einmal mehr ein Viertel der Menge von 2015. Seither hat sich die Ölförderung auf niedrigem Niveau wieder stabilisiert.
Die Einnahmen des Staates unterlagen damit einer gravierenden Einschränkung. Das ist letztlich auch die Erklärung für die anderen, in Venezuela zu beobachteten Krisensymptome. Da wären zu nennen:
Ein gravierender Mangel an Waren. Wie gesagt, Venezuela war und ist stark importabhängig. Durch den massive Rückgang der Exporteinnahmen konnten viele der früher üblichen Importe nicht mehr bezahlt werden. Als Folge verschärften sich von Jahr zu Jahr die Engpässe bei sehr vielen Waren, auch bei Waren des täglichen Bedarfs.
Der Warenmangel wurde begleitet von einer galoppierende Inflation. Die Inflationswerte waren in Venezuela schon immer vergleichsweise hoch, auch schon vor Chavez. Es gab kaum ein Jahr mit Werten unter 20 %. Aber ab 2015 erlebte das Land einen sprunghaften Anstieg der Teuerung, der alle bisher aufgetretenen Ausmaße weit hinter sich ließ. Es folgten einige Jahre mit extremer Hyperinflation. Der Höhepunkt war 2018, mit einer Inflationsrate die, laut venezolanischer Zentralbank, in diesen Jahr 130 060 Prozent betrug. Andere Quellen nennen noch höhere Inflationsraten, bis zu über 1 Million Prozent. Danach gingen die Inflationsraten zwar wieder deutlich zurück, blieben aber auf einem hohen Niveau.
Für die Bevölkerung bedeutete dies einen täglichen Kampf ums Überleben. Praktisch alles, einschließlich Nahrungsmittel und lebenswichtige Medikamente, war kaum mehr erhältlich und wenn, dann zu unerschwinglichen Preisen. Die Armutsquote stieg auf angeblich über 90 Prozent der Bevölkerung. Erscheinungen wie Unter- und Mangelernährung, die man bereits überwunden glaubte, griffen wieder um sich. Das Gesundheitssystem war am Zusammenbrechen. Viele Medikamente und alle etwas aufwändigeren Behandlungen konnten nicht mehr bereitgestellt werden. Kriminalitäts- und Mordraten erreichten neue Höhepunkte.
Unter diesen Umständen verließ ein erheblicher Teil der Einwohner das Land. Die genauen Zahlen sind umstritten. Maximal ist von bis zu 7 Millionen Menschen die Rede. Einige Millionen werden es mit Sicherheit gewesen sein, die vorübergehend oder dauerhaft ausgewandert sind.
In den letzten Jahren, etwa ab 2020, hat sich die Situation etwas beruhigt. Bei den wichtigen Kennzahlen kam es zu einer gewissen Stabilisierung. Bei der Ölförderung konnte 2024 wieder eine Steigerung auf 853 000 Barrel pro Tag erreicht werden. Die Inflationsraten sind immer noch hoch. Die genannten Zahlen sind je nach Quelle unterschiedlich, aber es besteht Übereinstimmung darin, dass die Hyperinflation überwunden ist. Die Zentralbank berichtet für 2023 von 190 % Preissteigerung, zum 1. Mai 2024 werden für die vergangenen 12 Monaten 67% genannt, bei deutlich fallender Tendenz.
Einordnung und Bewertung
Chavez hatte das Glück, dass zu seinen Amtszeiten die Einnahmen sprudelten. Sie wurden durchaus sinnvoll eingesetzt, hauptsächlich für viele soziale Verbesserungen. Was aber nicht geschah, war eine wesentliche Verbreiterung der produktiven Basis und/oder eine Rücklage für schlechtere Zeiten.
Als dann die Einnahmen immer geringer wurden, hat die Regierung nicht ihre Ausgaben reduziert, sondern versucht, die fehlenden Mittel zuerst einmal durch Gelddrucken auszugleichen. Gelddrucken bedeutete in der damaligen Situation die Ausweitung der Zentralbankgeldmenge, ohne dass diese zusätzliche Geldmenge durch Güter und Waren, die ja nicht mehr importiert werden konnten, gedeckt gewesen wäre. Da der Rückgang der Staatseinnahmen nicht begrenzt blieb, sondern sich von Jahr zu Jahr verschärfte, wurde das Gelddrucken offensichtlich immer hemmungsloser praktiziert, wie der Verlauf der Hyperinflation anzeigt. Eine Hyperinflation mit astronomischen Preissteigerungswerten wie in Venezuela in den Jahren um 2018 ist nur durch eine massive, ungedeckte Ausdehnung der Zentralbankgeldmenge erklärbar.
Gelddrucken war aber nicht das einzige, was versucht wurde, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig wurden umfangreiche Devisenkontrollen und Preisüberwachungen eingeführt. Für Bedürftige wurde ein System der direkten Verteilung von Lebensmitteln aufgebaut. Bei Verstößen gegen diese Maßnahmen wurden strenge Strafen angedroht. Es gab auch durchaus die Forderung nach einer noch weiteren Verschärfung des Klassenkampfes, z.B. von der KP (PCV = Partido Comunista de Venezuela). Denn wenn der Gegner Waren hortet, die Preise treibt usw., muss man ihn daran hindern, indem man ihm die Verfügungsgewalt über diese Dinge nimmt. Allerdings scheinen alle diese Maßnahmen nicht sehr effektiv gewesen zu sein. Auch Verstaatlichungen von Betrieben haben des öfteren dazu geführt, dass deren Produktion noch weiter gesunken, manchmal auch vollkommen zum Erliegen gekommen ist. Warum war man nicht in der Lage, Produktion und Preise wirkungsvoll zu kontrollieren ? Fehlte es an Unterstützung aus der Bevölkerung, gab es nicht genug qualifizierte Aktivisten oder schreckte man vor Konsequenzen zurück ? Die Kontrollmaßnahmen sind letztlich gescheitert. Das lässt sich als Ergebnis feststellen, auch wenn die Gründe dafür von uns nicht im einzelnen nachvollzogen und beurteilt werden können.
Ab 2018 wurden immer deutlicher Versuche erkennbar, mit anderen Mitteln die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Zu nennen wäre einmal die Einführung des „Petro“. Der Petro war eine von Venezuela entwickelten Kryptowährung, deren „Wert“ an den Preis des Öls gekoppelt sein sollte. Damit wurde versucht, einen auch international stabilen Anker für die einheimische Währung, den Bolivar, zu schaffen. Dieser Ansatz wurde aber bereits nach kurzer Zeit wieder aufgegeben und nicht mehr aktiv weiterverfolgt. Im Januar 2024 schließlich wurde der Petro ganz abgeschafft, übrigens ohne jede offizielle Begründung. Stattdessen wurde eine stillschweigende Dollarisierung zugelassen. In mehreren Schritten wurden seit 2018 die Devisenkontrollen gelockert, Dollarkonten erlaubt und elektronische Zahlungssysteme eingeführt, die Transaktionen auf Dollarbasis ermöglichen. Inzwischen scheint der Dollar de facto das eigentliche Zahlungsmittel in Venezuela zu sein. Der Bolivar ist real nur noch eine Verrechnungseinheit, die von jedermann ständig in Dollar umgerechnet wird (auch automatisch zum jeweils tagesaktuellen Kurs).
Gleichzeitig wurden neben den Devisenkontrollen auch die Preiskontrollen und andere Überwachungsmaßnahmen für die Privatwirtschaft reduziert. Es wird wieder versucht die wirtschaftliche Tätigkeit von Privaten anzuregen. Entsprechende Aussagen findet man in Reden von Ministern und von Präsident Maduro. Allerdings enthalten diese nur relativ allgemeine und vage Ausführungen und keine ausführlichen und tiefer gehenden Begründungen.
Ein weiterer Ausdruck der Wende in der Wirtschaftspolitik stellt das Einfrieren der Löhne und Renten und der Übergang zu Bonuszahlungen dar. Diese „Bonification“, wie sie genannt wird, ist eine typische Eigenheit Venezuelas. Tarifliche Lohnvereinbarungen sind ausgesetzt und der staatliche Mindestlohn ist seit März 2022 auf 130 Bolivar eingefroren, damit auch die Renten, die an den Mindestlohn gekoppelt sind. Wegen der Inflation ist aber die Kaufkraft stark gesunken und sinkt ständig weiter (die 130 Bolivar entsprachen im März 2022 etwa 30 US-Dollar, inzwischen, im Mai 2024, sind es nur noch 3,60 $). Um diesen ständigen Verlust zumindest einigermaßen auszugleichen, werden Boni und Prämien gewährt.
Konkret schaut das so aus: Der eigentliche Lohn, der sogenannte Vertragslohn, ist für die Venezolaner nur noch ein kleiner Teil des monatlich verfügbaren Einkommens, individuell ist das unterschiedlich, aber mehr als um die 5 % ist es meistens nicht. Der Lohn wird dann durch - meistens mehrere – Bonuszahlungen ergänzt. Es gibt regelmäßige Bonuszahlungen und einmalige Boni, größere (mit einen Umfang von z.B. 100 $) und kleinere mit 2,50 $ oder ähnlichen Größenordnungen pro Monat. Die Zahlung erfolgt jeweils beim Vorliegen bestimmter Bedingungen. Ergänzt werden kann das durch Sozialleistungen, manchmal auch Boni genannt - das wird nicht immer klar unterschieden -, die über das „carnet de la patria“ (Bürgerpass oder Sozialausweis) bezogen werden. Darüber können Bedürftige z.B. auch Lebensmittelpakete erhalten.
Die Situation ist unübersichtlich. Für den Beobachter aus Deutschland ist es unklar, wie vollständig die Bevölkerung vom Bonussystem erfasst wird und wer eventuell durch dieses soziale Netz fällt. Es ist kaum nachvollziehbar, wer genau warum welche Boni bekommt. Man findet dazu keine systematischen Darstellungen, nur Einzelberichte.
Für einfache Arbeiter beim Ölkonzern PDVSA wird 2023 berichtet, dass sich ihr Gesamteinkommen zwischen 100 und 200 Dollar bewegt. Stahlarbeiter kommen auf 200 $ und bis zu 80 $ Zulagen (2023). Staatlich Beschäftigte erhalten einen Bonus von 100 $, der zum 1. Mai 2024 auf 130 $ erhöht wurde. Dieser Staatsbonus gilt anscheinend auch für Rentner. Es gibt auch einen Wirtschaftskriegsbonus, der ebenfalls am 1. Mai von 60 auf 90 $ erhöht wurde. Eine Angestellte einer staatlichen Telekommunikationsfirma berichtet dagegen von einem Einkommen von nur ca. 70 $, davon 1,80 $ als Vertragslohn. Der Rest ist eine sogenannte Arbeitsplatzprämie und ein Lebensmittelpaket im Wert von 50 $. Warum sie den Staatsbonus von 100 bzw. 130 $ nicht erhält, bleibt unklar.
Die Boni werden einseitig gewährt, sie sind in keiner Weise vertraglich abgesichert. Es scheint auch eine erhebliche Dynamik zu geben. Manche Boni fallen plötzlich wieder weg und werden durch neue, aber nicht identische ersetzt oder durch die Erhöhung von anderen, bereits existierenden ausgeglichen, mal mehr, mal weniger vollständig. Dies und insbesondere einmalig gewährte Boni bringen ein erhebliches Maß an Unsicherheit mit sich.
Die mit den Boni verbundenen Geldbeträge werden auch von offizieller Seite in Dollar angekündigt. Die Auszahlung erfolgt zwar in Bolivar, die Umrechnung Dollar zu Bolivar aber zu den tagesaktuellen Wechselkursen, wodurch ein gewisser Inflationsschutz gegeben ist.
Die Boni sind erklärtermaßen nur Notfallmaßnahmen und sollen in Zukunft wieder durch ein „normales“ System ersetzt werden, d.h. mit Vertragslöhnen, die den Lebensstandard sichern, vermutlich auch wieder mit Sozialabgaben, Steuern etc.. Zur Zeit ist das aber noch nicht in Sicht.
Das „carnet de la patria“ ist auch Auslöser von Kontroversen, besonders bei oppositionell Gesinnten. Zur Kontrolle der Abgabe der Sozialleistungen werden persönliche Daten erfasst, neben Name und Adresse auch Einkommensdaten, Vereins- und Parteimitgliedschaft und Social-Media-Konten. Deshalb wird der Vorwurf erhoben, das „carnet“ diene hauptsächlich der politischen Kontrolle der Bevölkerung. Die Regierung scheue nicht einmal davor zurück, dafür auch zum Überleben notwendige Sozialleistungen einzusetzen.
Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Ursprünglich waren in Venezuela, wie in vielen anderen Ländern auch, an die Löhne Leistungen wie Urlaubsgeld, Abfindungen bei Entlassungen, Abgaben für die Rentenversicherung und manchmal auch für zusätzliche Krankenversicherungen gebunden. Formal ist das zwar immer noch so, aber die darüber bewegten Beträge sind inzwischen so winzig, dass sie eigentlich vernachlässigt werden können. Das bedeutet unter anderem, ein funktionierendes Rentensystem gibt es in Venezuela zur Zeit nicht.
Die tieferen Ursachen der ökonomischen Krise
Bei den Rohölpreisen ist die Analyse einfach. Es handelt sich um eine einseitige Abhängigkeit Venezuelas vom Weltmarkt. Die Ölproduzenten der OPEC, Venezuela ist Gründungsmitglied, versuchen zwar immer wieder die Preise in ihren Sinne zu stabilisieren, aber nur mit mäßigem Erfolg. Zu groß sind die Einflüsse der Faktoren, die die Öl produzierenden Länder nicht beeinflussen können, seien es neue Technologien bei der Förderung wie das Fracking, Nachfrageschwankungen in der Folge des weltweiten Konjunkturverlaufs oder politische Krisen mit ihren Auswirkungen auf Produktion, Transport und Nachfrage von Erdöl.
Die Ursachen des Rückgangs der Ölförderung sind schwieriger festzustellen. Offizielle venezolanische Stellen nennen als Grund für die Probleme die Sanktionen, insbesondere die der USA. Es ist vom Wirtschaftskrieg der USA gegen Venezuela die Rede. Und sie haben damit durchaus recht. Es kann nicht bestritten werden, dass die Sanktionen das Ölgeschäft und auch die sonstige Wirtschaft ganz erheblich behindern und für Venezuela ein großes Problem darstellen. Insbesondere dürfte das Land für sein exportiertes Öl nicht mehr die am Weltmarkt üblichen Preise erzielen, weil den Abnehmern, die als Sanktionsbrecher Risiken eingehen, niedrigere Preise gewährt werden müssen. Viele Sanktionen lassen sich zwar irgendwie umgehen, aber nur mit erheblichem Mehraufwand und zu hohen Kosten.
Aber die Sanktionen reichen als Erklärung nicht aus, hauptsächlich wegen des zeitlichen Ablaufs. Der Produktionseinbruch ist bereits in den Jahren 2016 und 2017 deutlich zu erkennen. Die schärferen Sanktionen wurden aber erst 2018 und besonders dann 2019 verhängt (siehe Kasten). Insgesamt ist festzustellen, dass die Sanktionen nicht die gleiche Schärfe aufweisen wie die gegen Iran oder Russland. Und es scheint so, dass andere Länder mit vergleichbaren Sanktionen besser umgehen konnten.
Sucht man nach weiteren Ursachen, stößt man auf Ereignisse aus den Jahren 2002 - 2003. In diesen Jahren gab es den sogenannten „Generalstreik“. Streik steht in Anführungszeichen, weil es sich dabei nicht um einen echten Arbeitskampf, etwa um höhere Löhne, gehandelt hat. Der Aufruf zum „Streik“ kam bezeichnender Weise gemeinsam von Unternehmensverbänden und den CTV, einem Gewerkschaftsdachverband, der mit der alten Regierung vor Chavez eng verbundenen war. Das ursprüngliche Ziel dieser Aktion war, den Rücktritt von Chavez zu erzwingen. Trotz der üblichen Bezeichnung Generalstreik war vor allem der staatliche Erdölkonzern PDVSA (Petroleos de Venzuela S.A. = Petroleum von Venezuela Aktiengesellschaft) betroffen. Dort kam es zu Arbeitsverweigerungen und Sabotageaktionen, die den Konzern zeitweise lahmlegten. Bei den „Streikenden“ soll es sich hauptsächlich um Manager, Führungskräfte und Spezialisten gehandelt haben. Es war ein Kampf um Einfluss und Macht. PDVSA war und ist bekanntlich der Schlüsselbetrieb in Venezuela. Im Verlauf dieses Konflikts wurden 18 000 Beschäftigte, von insgesamt ca. 80 000, entlassen, hauptsächlich die Träger des „Streiks“, das heißt Manager, Führungskräfte und Spezialisten. Führungskräfte wurden oft durch Militärangehörige ersetzt. Danach war die Führung des PDVSA politisch loyal, aber es ist fraglich, ob es gelang, alle Entlassenen durch ausreichend qualifiziertes Personal zu ersetzen.
PDVSA war nicht nur Objekt eines Machtkampfs, die Regierung hat den Konzern auch als vermeintlich einfache Geldquelle für alles mögliche herangezogen. Ihm wurden viele Aufgaben außerhalb des Ölgeschäfts, die eigentlich mehr Aufgaben sozialer Art waren, übertragen.
2007 wurden die ausländische Partner der PDVSA darauf verpflichtet, ihren Anteil an joint ventures (es handelte sich dabei im wesentlichen um Ölfelder, die gemeinsam ausgebeutet werden) auf maximal 40 % zu reduzieren. Die Liste mit den ausländischen Partnern enthielt die Namen fast aller großen Ölmultis. Mit einigen konnte eine Einigung erzielt werden, mit zwei der wichtigsten, nämlich ExxonMobil und ConoccoPhilips, aber nicht. Diese wurden daraufhin enteignet, was zu langandauernden Gerichtsverfahren vor internationalen Schiedsgerichten führte. Diese Konfrontation dürfte dem PDVSA aus technischen und organisatorischen Gründen, z.B. was die Sicherung von Absatzwegen betrifft, zusätzliche Schwierigkeiten bereitet haben.
Es ist davon auszugehen, dass alle diese Ereignisse dazu beigetragen haben, die Funktionsfähigkeit von PDVSA zu beeinträchtigen. Wahrscheinlich wurde die notwendige Wartung der Ölförderungsanlagen vernachlässigt und vermutlich waren die getätigten Erhaltungsinvestitionen zu gering. Sparen am Unterhalt kann für einige Zeit ohne allzu großen Folgen scheinbar funktionieren. Mit einer zeitlichen Verzögerung machen sich dann aber unweigerlich die negativen Auswirkungen bemerkbar, in diesem Fall durch einen drastischen Rückgang der Mengen des geförderten Erdöls.
Das ist auch die Einschätzung vieler Beobachter, die von Ausplünderung und Herunterwirtschaften des Ölsektors sprechen. Sicher, diese Beobachter stehen den politischen Verhältnissen in Venezuela oft ablehnend bis feindlich gegenüber. Das sollte man nicht vergessen. Aber es ist anzunehmen, dass die Einschätzungen zumindest einen realistischen Kern enthalten.
Es gibt im Zusammenhang mit der Ölförderung auch viele Gerüchte und Anschuldigungen bezüglich massiver Korruption. Erhebliche Ölmengen sollen in dunkle Kanäle abgezweigt worden sein. Von zwielichtigen Geldströmen, Scheinaufträgen an obskure Firmen und dergleichen mehr ist die Rede. Korruption in großem Ausmaß kann auch von offizieller Seite nicht grundsätzlich abgestritten werden. Es gab schließlich mehrere spektakuläre Verhaftungen aus solchen Gründen.
Von hier aus und auf Basis der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Informationen ist allerdings eine definitive Beurteilung der Vorgänge, die den Rückgang der Ölproduktion verursachten, im einzelnen nicht möglich. Über viele Punkte können wir keine wirkliche Klarheit gewinnen. Fest steht aber, die geförderten und exportierten Ölmengen sind erheblich zurückgegangen, mit der Folge eines riesigen Lochs bei den Staatseinnahmen. Auf staatlichen Leistungen beruhte aber der Erfolg des bolivarischen Wegs unter Chavez. Hauptsächlich wegen des Rückgangs der Öleinnahmen brach die materielle Basis für diesen Erfolg zusammen.
Fazit
Wir haben in Venezuela ein System, in dem die Regierung und andere wichtige Akteure wie etwa der PSUV eine ausgesprochen linke Rhetorik pflegen und in harter Konfrontation zur bürgerlichen bzw. rechten Opposition (und dem sie unterstützenden Ausland) stehen. Die Verhältnisse in Venezuela können aber nicht als sozialistisch bezeichnet werden. Das ist zur Zeit objektiv nicht zutreffend, auch wenn es ein Land mit einem großen staatlichen Sektor ist. Die tatsächliche Politik hat unter dem Druck der Krise eine wesentliche Wende vollzogen. Dabei ist nicht ganz klar, ob die Wende ausschließlich durch die Umstände erzwungen wurde, oder ob ihr auch eine politische Bedeutung, etwa für die zukünftige Entwicklung, zukommt. De facto läuft die Wirtschaft nur auf Dollarbasis. Die Privatwirtschaft wird wieder zu größeren Aktivitäten ermuntert. Viele Regulierungen sind entweder aufgehoben oder wegen der geänderten Umstände nicht mehr anwendbar. Einmal bestehende Sozialleistungen wurden durch die Hyperinflation pulverisiert. Zugespitzt könnte man sagen, dass eine sozialistisch auftretende Regierung auf einer ökonomischen Basis operiert, die inzwischen auch einem Neoliberalen wieder gefallen könnte.
Für die Zukunft steht die Überwindung des Systems der Boni an. Noch ist nicht bekannt, wann und nach welchem Plan oder gemäß welcher Kriterien das im Einzelnen geschehen soll. Dieser Prozess wird auf jeden Fall entscheidend für die zukünftigen sozialen Verhältnissen in Venezuela sein, denn es muss neu festgelegt werden, wer aus welchen Gründen welches Einkommen erzielt oder erzielen kann. Klar sichtbar ist aber bereits, dass der materielle Rahmen dafür begrenzt ist. Es gibt nicht sehr viel zu verteilen. Realistischerweise muss man davon ausgehen, dass der Lebensstandard und die sozialen Verhältnisse, wie sie vor der Krise etwa um das Jahr 2013 vorhanden waren, auf absehbare Zeit nicht wieder erreicht werden können. Dafür wäre es notwendig, die produktive Basis des Landes erheblich auszuweiten, sei es über eine Steigerung der Ölförderung oder über andere Aktivitäten.
Solche anderen Aktivitäten, die Förderung von Gold, Coltan und anderer Bodenschätze (Eisenerz, Bauxit, Kohle) oder ein Ausbau der Landwirtschaft, wurden immer wieder angekündigt. Anscheinend blieb es aber oft bei den Ankündigungen. Wenn etwas angepackt wurde, dann nur mit mäßigem Erfolg. Insgesamt scheinen die Alternativen zum Öl noch kein Ausmaß erreicht zu haben, das gesamtwirtschaftlich von größerer Bedeutung wäre, vielleicht mit Ausnahme der Goldförderung. Deren Umstände sind aber nicht sehr transparent. Denn die Goldförderung unterliegt der Kontrolle des Militärs und ihr Ertrag ist letztlich geheim.
Es ist also ein bitteres Fazit zu ziehen. Der bolivarische Prozess hat unter günstigen Rahmenbedingungen Erfolge erzielt und Verbesserungen für große Teile der Bevölkerung erreicht. Diese Erfolge konnten aber unter den folgenden, wesentlich schlechteren Bedingungen nicht behauptet und verteidigt werden.
Es gab immer schon linke Stimmen, die bezüglich der Erfolgsaussichten skeptisch waren und auf ungünstige Ausgangsbedingungen hingewiesen haben. Etwa auf die geringe Industrialisierung und die relativ kleine Arbeiterklasse. Ein sehr großer Teil der nicht privilegierten Schichten war im informellen Sektor tätig. Das sind sicher zuerst einmal nur pauschale Feststellungen. Aber es macht dann schon einen Unterschied, ob für eine Produktionskontrolle von unten ein Reservoir an Aktivisten vorhanden ist, die erfahrene Produktionsarbeiter sind, oder eben nicht. Dazu kommen die grundsätzlichen Schwierigkeiten, den Weg zum Sozialismus nur in einem Land gehen zu wollen, in einem Land, das relativ klein und praktisch vollständig vom Weltmarkt abhängig ist, in einem Land, das viele Feinde, aber nur wenig Freunde hat. Das verbündete Kuba ist ebenfalls klein und befindet sich selbst in einer Krise.
In Venezuela hat sich die Auseinandersetzung zugespitzt auf die Frontstellung Regierung gegen die (rechte) Opposition. Diese stehen sich in harter Konfrontation gegenüber. Dabei ist anscheinend das Militär eine stabile Stütze der Regierung, was bisher alle Umsturzversuche hat scheitern lassen. Auch wenn das Militär ein entscheidender Machtfaktor ist, heißt das nicht, dass es die einzige Basis der Regierung wäre. Diese dürfte in der Bevölkerung noch in erheblichem Ausmaß Unterstützung mobilisieren können, wenngleich auch deutliche Anzeichen von Frustration über die Krisenauswirkungen zu erkennen sind. Auch das administrative Vorgehen3 der Regierung gegen bisherige Bündnispartner, wie z.B. die KP, macht die vorhandenen Risse sichtbar.
Viele Fragen bleiben noch offen. Auch die einer abschließenden Einschätzung. Stark zugespitzt stellt sich die Frage: Kann der bolivarische Prozess für Venezuela noch ein Weg in eine bessere Zukunft oder gar zum Sozialismus sein, wie widersprüchlich und mühselig auch immer, oder ist er letztlich eine Sackgasse?
2 Alle genannten Rohölpreise sind die von der OPEC berichteten durchschnittlichen Weltmarktpreise. Die von den einzelnen Produzenten tatsächlich erzielten Preise können davon abweichen.
3 https://amerika21.de/2023/08/265370/tsj-vorstand-pc-venezuela , das oberste Gericht setzte bei der PCV einen Ad-hoc-Vorstand ein, gegen den Willen der Mehrheit in der Partei. Anlass war die Klage einer Minderheitsfraktion der PCV, die die Kritik der PCV an der Regierung (seit dem Parteikongress von 2022) nicht mitträgt.
Politische Ereignisse
Dezember 1998 Hugo Chavez wird mit 56 % der Stimmen zum Präsidenten gewählt
1999 die neue bolivarische Verfassung wird beschlossen
2002 „Streik“ bzw. Sabotage bei PDVSA, Steuerstreik der Wohlhabenden, Putschversuch
2004 Referendum zur Abwahl von Chavez, in der folgenden Abstimmung wird Chavez mit über 59% der Stimmen bestätigt
2006 Wiederwahl von Chavez mit fast 63 %
2007 ausländische Partner der PDVSA müssen ihren Anteil an joint ventures (sprich Ölfelder) auf maximal 40 % reduzieren, Einigung mit Total, Chevron, Statoil und BP, keine Einigung und deshalb Enteignung der Anteile von ExxonMobil und ConoccoPhilips
Oktober 2012 dritte Wiederwahl
März 2013 Tod von Hugo Chavez
April 2013 Nicolas Maduro wird mit 50,78% zum Präsidenten gewählt
2014 große oppositionelle Demonstrationen wegen Inflation, Warenknappheit, Kriminalität
März 2015 Obama unterzeichnet die Executive Order 13692, Beginn der Sanktionen
Dezember 2015 Wahl zur Nationalversammlung, Opposition gewinnt absolute Mehrheit
März 2016 Opposition startet mit einem Referendum zur Abberufung des Präsidenten Maduro, dieses findet letztlich nicht statt, Streit um Unterschriften und Verzögerungstaktik der Regierung
März 2017 das Oberste Gericht entzieht der (oppositionellen) Nationalversammlung die Kompetenzen, die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung wird initiiert und im Juli durchgeführt; alle diese Schritte sind stark umstritten und werden von der Opposition bekämpft
2018 Höhepunkt der Inflationsrate
März 2018 Verhaftung von Miguel Eduardo Rodriguez Torres wegen "Handlungen gegen die öffentliche Ordnung und Ruhe sowie einer Verschwörung mit dem bösartigen Ziel, die monolithische Einheit der Bolivarischen Streitkräfte zu bedrohen". Gleichzeitig wurden 28 weitere Personen aus den Streitkräften festgenommen. Torres war ein Gefährte von Chavez, bis 2014 war er Innenminister. Beobachter vermuten, dass Torres, von einer linken Position ausgehend, die Wende in der Wirtschaftspolitik abgelehnt hat. Im Januar 2023 wurde er aus der Haft entlassen undkonnte nach Spanien ins Exil gehen.
Mai 2018 Wiederwahl von Maduro, offiziell 46 % Wahlbeteiligung und 68 % Zustimmung
Januar 2019 die (oppositionelle) Nationalversammlung erklärt die Wahl Maduros für ungültig und Juan Gaido erklärt sich zum Interimspräsidenten, was umgehend von den USA und etlichen anderen Staaten anerkannt wird, Demonstrationen und Kämpfe in Venezuela, Verschärfung der Sanktionen der USA und anderer Staaten
2020 Tiefpunkt der Erdölförderung
Mai 2020 Versuch einer Invasion
2021 auf Vermittlung von Norwegen und Mexiko Kontakte zwischen Regierung und Opposition
Ende 2022 die oppositionelle Nationalversammlung beschließt das Ende der Übergangsregierung Gaido, in der Folge weitere Gespräche Regierung/Opposition, Gespräche mit den USA, Lockerung von Sanktionen, Ölmultis beteiligen sich mit Zustimmung der USA wieder an joint ventures
April 2024 Verhaftung von Tarek El Aissami, El Aissami hatte seit 2007 mehrere Ministerposten inne, 2018 wurde er Vizepräsident und 2020 Erdölminister. Im März 2023 trat er von seinen Ämtern zurück, weil wichtige Vertraute von ihm wegen Korruption verhaftet wurden. Jetzt wird ihm selbst Korruption in großem Stil vorgeworfen (Schaden von 23 Milliarden $). Mit ihm wurden auch noch andere hochrangige Personen festgenommen. Die USA werfen ihm Verwicklung in den Drogenhandel vor und Kontakte zum mexikanischen Kartell Los Zetas, seit 2017 steht er auf der Sanktionsliste der USA.
Juli 2024 Wiederwahl von Maduro, erneute Konfrontation mit Opposition, USA verschärfen die Sanktionen wieder
Sanktionen
Bei den ersten US Sanktionen mit Bezug zu Venezuela ging es noch hauptsächlich um die Verhältnisse in Kolumbien, sie richteten sich insbesondere gegen die FARC. 2008 wurden z.B. regierungsnahe Personen aus Venezuela sanktioniert, weil ihnen vorgeworfen wurde, die FARC zu unterstützen bzw. am Drogengeschäft beteiligt zu sein.
Ab 2015 wurden weitere Sanktionen gegen venezolanische Personen verhängt, die Liste der sanktionierten Personen wird immer länger.
März 2015 Obama unterzeichnet die Executive Order (EO) 13692, die Venezuela zu einer "ungewöhnlichen und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten" erklärt. Konkret und unmittelbar sind die Folgen gering, es wird nur der US-Besitz von 7 venezolanischen Personen blockiert. Die EO ist aber die formalrechtliche Basis für viele weitere Sanktionen. Außerdem dürfte die Einstufung als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA grundsätzlich abschreckend gewirkt haben. Viele potenzielle Geschäfte mit Venezuela sind deshalb vermutlich nicht mehr zustande gekommen, obwohl sie nicht direkt sanktioniert waren. Manche Beobachter bezeichnen die EO deshalb als Beginn des Wirtschaftskrieges der USA gegen Venezuela.
Die wirklich einschneidenden Maßnahmen kommen aber erst unter Trump, 2017 und später.
August 2017 Finanzsanktionen, Verbot des Handels mit venezolanischen Bonds an US-Märkten, das sollte die Finanzierungsmöglichkeiten von PDVSA treffen
2018 und 2019 folgen einer Reihe von weiteren Sanktionen, die ziemlich umfassend sind. Das Hauptziel ist die PDVSA. Zahlungen an diese Firma werden blockiert, der Handel mit ihr verboten, ebenso werden der Gold- und Bergbausektor und Banken sanktioniert, Citgo wurde der Gaido- Regierung unterstellt
Citgo war und ist ein US-amerikanisches Tochterunternehmen der PDVSA (1986 wurden 50% erworben, 1990 die restlichen 50 %) mit drei Raffinerien und etwa 4000 Tankstellen in den USA, Umsatz um die 24 Milliarden Dollar, Bilanzgewinn (2019) 246 Millionen, seit 2019 hat Venezuela keine Zahlungen mehr von Citgo erhalten,
Seit 2018 sind venezolanische Goldbestände, die bei der Bank von England gelagert werden, durch die britische Regierung blockiert, deren Wert wird auf etwa 1,7 Milliarden Dollar geschätzt.