Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiter selbst sein!
Arbeiterstimme
Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis
Literaturtipp
Der spanische Bürgerkrieg
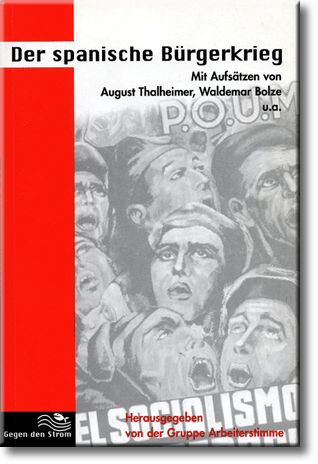
Die Niederlage der spanischen Republik 1939 war eine Niederlage für die spanische und internationale Arbeiterbewegung und ist bis heute Thema ungezählter Bücher.
Die Aufsätze in dem vorliegenden Buch sind erstmalig in der Arbeiterstimme in den Ausgaben September 1986 bis Oktober 1987 veröffentlicht und später in einer Broschüre zusammengefasst worden.
Nr. 227
Sofort nach dem Sturz des Assad-Regimes wurde über die Abschiebung von Flüchtlingen aus Syrien debattiert, soweit sich die nicht hier nützlich machen und zum Beispiel den Personalmangel im Gesundheitswesen mildern helfen. Die Politiker:innen zeigten sich hoch zufrieden über das Ende der „Schreckensherrschaft“ von Assad. Man hofierte den Anführer der multinationalen Dschihadistenmiliz, die nun den größten Teil Syriens kontrolliert. Es dauerte etwas, bis bei europäischen Politiker:innen, darunter sogar der Protagonistin einer „feministischen Außenpolitik“, Ernüchterung eintrat.
Das Alltagsleben war und ist für die Menschen in Syrien nach wie vor bedrückend. Es gab selten Strom. Der Brotpreis war um das Zehnfache gestiegen. „Syrische Städte sind von Zerstörung, Plünderung und improvisierter Ordnung geprägt“, so die Korrespondentin Karin Leukefeld Anfang Januar.i Ämter wurden in Brand gesetzt. Vor allem wissen die Menschen nicht, was die Zukunft unter dem neuen Regime bringen wird.
Die religiösen Minderheiten (Alawiten, Drusen, Christen verschiedener Konfessionen und Schiiten) waren von Anfang an besorgt, und das offenbar zu recht. Nach Angaben der „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ (SOHR) sollen bereits Ende Dezember in der Küstenregion um Latakia, einem stark von Alawiten besiedelten Gebiet, vierzehn Menschen getötet worden sein. Ende Januar las man von einem ersten Massaker in einem alawitischen Dorf, gestützt auf den Bericht einer libanesischen Journalistin. Bewaffnete seien mit Pick-ups in den Ort eingefallen, hätten um sich geschossen und geplündert. Es seien die Leichen von Dutzenden Männern aus dem Dorf gefunden worden, andere in einem Krankenhaus abgeladen worden. Ähnliches wurde der Journalistin über ein anderes Dorf erzählt. Die SOHR zählte in der vorletzten Januarwoche 35 getötete Alawiten, Schiiten und Murschidija, Anhänger einer islamischen Sekte, und außerdem 40 verschleppte und vermisste Personen.ii Anfang Februar zeigte sich der Menschenrechtsverein Tüday e. V./Köln alarmiert über die Gefährdung der religiösen Minderheiten in Syrien, vor allem, aber nicht nur, der Alawiten. Auch Drusen hätten „erhebliche Sicherheitsprobleme“. Die christlichen Glaubensgemeinschaften stünden „unter massivem Druck“.iii
Die Infrastruktur ist aufgrund der Sanktionen, die seit über einem Jahrzehnt die Wirtschaft erdrosseln, heruntergekommen. Dazu kamen bis vor kurzem die Bombardements der israelischen Luftwaffe. Nach dem Regimewechsel flog diese hunderte Luftangriffe auf syrische Gebiete. Schon in den Jahren vorher hatte sie immer wieder nicht nur militärische Infrastruktur bombardiert. Grenzzonen im Norden sind von der Türkei besetzt, Gebiete im Nordosten und Süden von US-Einheiten, einzelne Flecken Landes von Kämpfern des IS. Auch das autonome Gebiet, das die Kurden noch halten, wird nicht von der Zentralmacht kontrolliert. Der Reportage von Karin Leukefeld kann man entnehmen, dass ausländische Unternehmen schon Syrien als Geschäftsfeld für sich entdeckt haben. Ein israelischer Anbieter habe den bisherigen Telekomdienst abgelöst. Kurz: Syrien steht nicht viel besser da als Afghanistan nach dem Ende des „Kriegs gegen den Terror“.
Tief greifende Veränderungen
Nach der Übernahme Syriens durch Dschihadisten sind tief greifende Veränderungen im ganzen Nahen Osten zu erwarten, erstens geopolitisch und zweitens kulturell. Die Region, darunter vor allem Syrien, ist über ein Jahrtausend von einer außerordentlichen kulturellen Vielfalt geprägt gewesen. Schon die Konflikte der letzten Jahrzehnte haben diese Vielfalt reduziert. Die jüngsten Ereignisse lassen nichts Gutes erwarten. Drittens ist zu befürchten, dass die früher relativ hohen Sozial- und Bildungsstandards in Syrien, aber auch im Irak, die schon bisher aufgrund der Kriege und der westlichen Sanktionen extrem gesunken sind, nicht mehr das alte Niveau erreichen, das sie unter der Zentralverwaltung der säkularen Baathisten hatten.
Für die USA, Großbritannien und Frankreich könnten die Folgen des von ihnen angestrebten Regimewechsels in Syrien enttäuschend ausfallen, weil inzwischen wirtschaftlich und militärisch starke Regionalmächte herangewachsen sind, die ihre Interessen wahrzunehmen wissen. Auch Interessengegensätze zwischen einem expansiven Israel und den westlichen Partnern sind nicht ausgeschlossen. Die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien waren die letzten hundert Jahre mit mehr oder weniger Erfolg bemüht, die Kontrolle über die Region zu behalten. Die aktuelle Konstellation scheint nur für die USA zukunftsoffen.
Ein historischer Rückblick
Man kann drei Phasen der westlichen Nahostpolitik unterscheiden: 1917 – 1945 eine Kolonialpolitik nach altem Muster von Seiten Frankreichs und Großbritanniens, 1945 – 1990 Regimechanges durch Putsche seitens der USA und GB, dazu die Aufrüstung Israels zum westlichen Brückenkopf, ab 1990 eine Phase der Stellvertreterkriege und der direkten militärischen Interventionen.
Der Nahe Osten war spätestens seit dem Zerfall des Osmanischen Reiches ein Objekt der Begierde für die westlichen Mächte, zunächst nach 1917 für Frankreich und Großbritannien. Am Zerfall hatte man kräftig mitgewirkt durch die Aufwiegelung der Armenier, der christlichen Maroniten und der Araber, denen man einen eigenen Staat versprochen hatte. Großbritannien und Frankreich gelang es, die Beute, d.h. die ganze Region zwischen der neuen Türkei im Norden und Saudi-Arabien im Süden, unter sich aufzuteilen (Sykes-Picot-Abkommen). Die Gebiete ließ man sich vom neuen Völkerbund als Mandatsgebiete zuteilen. Mesopotamien machten die Briten zu einer abhängigen Monarchie, Transjordanien zu einem Emirat. Die Franzosen sparten sich solchen Zauber bei Syrien, trennten aber den einträglichen Libanon ab, um dort mit der Protektion der christlichen Eliten eine Kompradorenbourgeoisie zu etablieren. Das Mandatsgebiet Palästina traten die Briten den Zionisten ab, die dort bald die ersten Siedlungen errichteten. Der arabische Nationalismus war zwar in Gärung, aber von der arabischen Aufstandsbewegung der 1930er Jahre in Palästina abgesehen, blieb es in der Region bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs überwiegend ruhig.
Nach dem Krieg sahen sich Frankreich und Großbritannien veranlasst – mit den USA und der Sowjetunion waren neue Großmächte auf den Plan getreten –, den Ländern die Unabhängigkeit zuzugestehen. Die hatte aber zunächst eher nur formalen Charakter. Die Systemkonkurrenz kam der arabischen Nationalbewegung zugute. In den 1950er Jahren putschten sich im Irak wie im nahen Ägypten nationalistische Offiziere an die Macht. Syrien folgte 1963. Vorausgegangen waren dort ein Staatsstreich 1949 und ein Versuch eines Staatsstreichs im Jahr 1957, beide von der CIA orchestriert. In den 1960er Jahren schüttelten auch Nord- und Südjemen die britische Herrschaft bzw. Oberhoheit ab. Im Libanon förderte die Sympathie der französischen Regierung für die christliche Oberschicht den Streit zwischen den Religionsgruppen und Ethnien, was die Einmischung von außen begünstigte. Wiederholte syrische Interventionen zeigten den Mangel an staatlicher Souveränität. Die palästinensische Flüchtlingswelle nach dem sog. Sechstagekrieg 1967, der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 und der zweimalige Einmarsch der israelischen Armee in den Jahren 1978 und 1982 destabilisierten das Land zunehmend.
Zum Teil konnten die arabischen Länder, wenn man von Jordanien, Saudi-Arabien und den Golfstaaten absieht, ihre staatliche Souveränität dank freundschaftlicher Beziehungen zur Sowjetunion und dank deren Militärhilfen wahren. Der Zusammenschluss in der Arabischen Liga gab den arabischen Staaten Selbstbewusstsein. Verbindend wirkte die gemeinsame Ablehnung der israelischen Staatsgründung auf Kosten des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser. Einen Angriff auf Israel wagten aber nur ein paar Staaten, allen voran Ägypten und Syrien, 1948 und 1973. Innenpolitisch herrschte überall ein autoritäres Patronagesystem, teilweise aber mit einer fortschrittlichen Bildungs- und Gesundheitspolitik verbunden.
Nach dem Ende der Sowjetunion machten sich die USA ihre unbestrittene Vorherrschaft in der unipolaren Weltordnung zunutze, um den Nahen Osten in ihrem Sinn umzukrempeln. Vorausgegangen war schon der zehnjährige Krieg in Afghanistan, wo sich 1979 die Sowjetführung in die Falle hatte locken lassen (Z. Brzezinski), weil die USA die Mudschaheddin aufrüsteten.
Vorausgegangen war auch der achtjährige Krieg, den die USA Saddam Hussein gegen das Mullahregime führen ließen, das sie mit der Okkupation ihrer Botschaft gedemütigt hatten. Als dieser sich zur Annexion von Kuweit verleiten ließ, verschaffte er den USA die Gelegenheit, dem Irak einen ersten vernichtenden Schlag zu versetzen. Sie konnten sich dabei nicht nur der Zustimmung der UNO, sondern einer internationalen Mehrheit sicher sein. Auch Russland fügte sich der neuen „regelbasierten Ordnung“. In der Operation Desert Storm zerstörte die US-Luftwaffe 1991 den größten Teil der irakischen Infrastruktur. Mit einem mehr als zehnjährigen Krieg auf niedriger Schwelle einschließlich Wirtschaftssanktionen warf man das Land um Jahrzehnte zurück. Den Rest erledigten die USA und Großbritannien mit der „Koalition der Willigen“ 2003 in der Operation Shock and Awe. Später wurden die Großstädte Falludja und Tikrit, die zu Zentren des Aufstands wurden, dem Erdboden gleichgemacht. Das geschah auch Mossul, wo sich der IS verschanzt hatte. Die Besatzungsmacht organisierte den Ausverkauf der irakischen Wirtschaft. Die Privilegierung der vorher benachteiligten Schiiten (zwei Drittel der Bevölkerung) schürte neue Feindseligkeiten zwischen den Konfessionen. Terroranschläge forderten zahllose Opfer. Die Sunniten wurden zur Rekrutierungsbasis des IS. Ein kurdischer Klan nutzte die Gelegenheit, sich ein eigenes Herrschaftsgebiet in Nordirak zu schaffen.
Heute ist der Irak ein politisch instabiles Land mit starken wirtschaftlichen Schwankungen. Er gehört zu den fragilsten Staaten weltweit. Die Arbeitslosigkeit ist hoch (um 15 Prozent). Enorm ist die Erwerbslosigkeit von Frauen. 2018 lebte eine Viertel der Bevölkerung in Armut. Seit 2003 haben 1,8 Millionen das Land verlassen, darunter vermutlich viele Hochqualifizierte. Für 10.000 Einwohner stehen 9,1 Ärzte zur Verfügung. Weite Landstriche sind nuklear von DU-Munition verseucht.
2011 brachen in allen arabischen Mittelmehranrainern Unruhen aus, die euphorisch als Arabischer Frühling bezeichnet wurden. Die spontanen Demonstrationen waren politisch äußerst heterogen. Die fehlende Bündelung der Interessen und fehlende Führung machten die Proteste anfällig für die Vereinnahmung durch islamistische Organisationen. In Ägypten kam die Muslimbruderschaft durch Wahl an die Macht. Sie wurde dann mit einem Staatsstreich beseitigt. In Syrien probte die Muslimbruderschaft den Aufstand, was dann zur Initialzündung für einen allgemeinen Widerstand wurde. Ein paar Offiziere bildeten die „Freie Syrische Armee“. In Ankara gründeten Oppositionelle den „Syrischen Nationalrat“. Gleich nutzten Regionalmächte ebenso wie die USA, Israel und die EU den Konflikt in ihrem Interesse. Die von Frankreich initiierten „Freunde des syrischen Volkes“ bildeten ein lockeres Bündnis, später abgelöst von einer US-geführten Allianz. Einigen war die Achse Iran – Syrien und Iran – Syrien – Hisbollah schon lange ein Dorn im Auge. Man schleuste Waffen ein, bewaffnete unter anderem den IS. Russland sah sich herausgefordert. Und mit Hilfe seiner Luftwaffe konnte die syrische Armee 2017 weite Gebiete zurückerobern. Deeskalationszonen trennten Regierungstruppen und islamistische Milizen. Einige begaben sich in der Region Idlib unter den Schutz der Türkei. Die Kurden verschanzten sich in der nördlichen Grenzregion. So blieb der Konflikt über Jahre eingefroren, wenn man von den wiederholten Militäroperationen der Türkei und den Luftangriffen Israels absieht. Die Wirtschaftssanktionen bereiteten die militärische Kapitulation vor. Der Überraschungsangriff der Dschihadistenmilizen war von der Türkei und Saudi-Arabien und auch von den USA unterstützt worden.
Die aktuelle Situation
Die aktuelle Situation Nahen Osten außerhalb Syriens stellt sich so dar: Die Menschen im Irak haben kaum eine Perspektive. Der Jemen leidet unter einem Krieg, seit die Saudis 2015 in den damaligen Bürgerkrieg eingegriffen haben. Die Palästinenser in der Westbank sehen sich der Vertreibungsstrategie Israels ausgeliefert, die in Gaza vegetieren unter unmenschlichen Bedingungen. Der Libanon kann als failed state gelten, die Ägypter leben wie vor 2011 unter einer Diktatur.
Die von der Dschihadistenallianz Haiat Tahrir al Scham (HTS) gebildete Übergangsregierung hat sehr rasch mit diplomatischen Kontakten auf höchster Ebene ihre engen Beziehungen mit Saudi-Arabien und der Türkei verdeutlicht. Die beiden Regionalmächte haben ein großes, aber unterschiedliches Interesse an Syrien. Erdogan ist die autonome kurdische Selbstverwaltung an der Grenze zur Türkei ein Dorn im Auge. Sein Bestreben, die Autonomieansprüche von Rojava zu negieren, deckt sich mit dem Interesse der neuen Zentralmacht, das ganze Territorium unter ihre Kontrolle zu bringen. Möglicherweise liebäugelt Erdogan auch mit Grenzkorrekturen, was ein Konfliktpotential bergen würde. Auch die Entmachtung der Kurden könnte zu Spannungen mit den USA führen, weil diese mit den Kurden den IS im Zaum halten, wenn das auch nur zur Rechtfertigung ihres Militärstützpunktes dienen mag. Aber denkbar sei auch ein Arrangement der beiden NATO-Staaten, meint Nicholas Heras vom Newlines Institute for Strategic and Policy.iv Die Interessen der Saudis und der HTS dagegen decken sich voll. Denn die Saudis finden in dem zerstörten Syrien großartige Investitionsmöglichkeiten für ihr überschüssiges Kapital, was sie für den Wiederaufbau des Landes fast unverzichtbar macht.
Saudi-Arabien würde damit einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf Syrien gewinnen, was in den USA schon die Befürchtung weckt, es könnte sich eine postamerikanische Ordnung in der Region etablieren, nachdem sie mit ihrer Irakpolitik nicht gerade gut gefahren sind (Heras). Aber Heras sieht nach wie vor Einflussmöglichkeiten für die USA. Es gelte, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Außerdem wendet sich die irakische Regierung wieder stärker den USA zu, um deren militärische Unterstützung im Kampf gegen einen eventuell erstarkenden IS in Anspruch nehmen zu können.v Ein weiterer Player ist Israel, das ebenso wie die Türkei zur Zeit Teile des syrischen Territoriums besetzt hält. Die Golanhöhen hat man mit Zustimmung der US-Administration zur ersten Amtszeit von Trump bereits annektiert. Israel strebt unter der gegenwärtigen rechtsextremen Regierung ein Großisrael an. Erdogan hat sich schon mehrmals, vor allem in der Palästinafrage, mit Israel angelegt. Heras schließt daher einen Konflikt zwischen der Türkei und Israel auf syrischem Boden nicht aus. Der Regime Change ist für die Israelis ambivalent. Ein großes Plus ist aus ihrer Sicht die Abtrennung der Iran-Connection zu Syrien und zur Hisbollah. Nicht einzuschätzen ist aber, welche Position die Dschihadisten künftig zum Widerstand der Hamas einnehmen werden.
Eindeutige Verlierer der geopolitischen Veränderung sind Iran und Russland, obwohl es Putin scheinbar gelungen ist, der neuen Herrschaft in Syrien die Zusicherung abzutrotzen, dass die russische Marine den Flottenstützpunkt Tartus weiter nutzen kann.
Keine guten Aussichten für die Menschen in der Region
Die religiöse und kulturelle Vielfalt ist gefährdet, wenn die Dschihadistenallianz internationale Anerkennung gewinnen und ihre Macht in Syrien festigen sollte. Islamistische Herrschaft war bisher noch nie tolerant, gleich in welcher Ausprägung (Muslimbruderschaft, Wahabismus, Salafismus). Auch säkulare Gruppen werden vermutlich Druck ausgesetzt sein. Das visionäre Modell Rojava wird kaum eine Chance haben. Das lässt neue Flüchtlingsströme befürchten. Die Iraker leiden schon länger unter den Feindseligkeiten zwischen Sunniten und Schiiten. Die Minderheit der Jeziden ist noch immer bedroht.
Auch für die maroden Bildungs- und Gesundheitssysteme, beide sowohl in Syrien als auch im Irak einst auf hohem Niveau, sind die Aussichten unter den jetzigen Verhältnissen nicht rosig.vi Der Irak leidet an den Folgen von Kriegen, Wirtschaftskrieg, US-Besatzungspolitik und Terror. Und für die Islamisten in Syrien dürfte Bildungs- und Sozialpolitik kaum Priorität haben. Die Menschen in der Region, den Libanon eingeschlossen, erwartet demnach eine bedrohliche Beschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten nach dem Human Developement Index.
Georg Auernheimer
Literatur:
Auernheimer, Georg (2018): Wie Flüchtlinge gemacht werden. Über Fluchtursachen und Fluchtverursacher. Köln: Papyrossa.
Leukefeld, Karin (2017): Flächenbrand. Syrien, Irak, die arabische Welt und der Islamische Staat. Köln: Papyrossa.
Lüders, Michael (2017): Die den Sturm ernten. Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte. München: C.H. Beck.
Suliman, Aktham (2017): Krieg und Chaos in Nahost. Eine arabische Sicht. Frankfurt/M.: 2017.
i In: Nachdenkseiten v. 06.01.2025
ii Siehe junge Welt v. 28.01.2025
iii Abgedruckt in der jungen Welt v. 07.02.2025
iv Nicholas Heras am 03.01.2025, https://newlinesinstitute.org/political-systems/forecasting-syria-in-2025/
v Jörg Kronauer: Alle Finger im Spiel. In: junge Welt v. 08./09.02.2025, S.13
v iFür den Irak siehe z. B. https://iktib.de/irak/ betr. Bildung und einen Bericht der RosaLux-Stiftung betr. Gesundheit https://www.rosalux.de/publikation/id/42596/von-toedlichen-wasserhaehnen-und-fiktiven-krankenhaeusern. Die 2015 aus Syrien Geflüchteten brachten beste Bildungsvoraussetzungen mit. Das konnten Flüchlingshelfer (mich eingeschlossen) bestätigen.
Am 28. Juli 2024 haben in Venezuela Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Nach dem amtlichen Ergebnis wurde Nicolas Maduro mit 51,2 % der Stimmen als Präsident wiedergewählt. Die Opposition sieht das ganz anders. Sie reklamierte den Sieg für ihren Kandidaten, Edmundo Gonzales, und spricht von massiven Wahlfälschungen des Regimes. Diese Kontroverse hat Venezuela wieder einen prominenten Platz in den Nachrichten verschafft.
Auch unabhängig von diesem aktuellen Anlass stellt sich die Frage: Wo steht Venezuela heute ? Was ist geblieben von der „bolivarischen Revolution“ und dem Aufbruch in Richtung „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Auch bei uns wurde die Rede vom „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ von vielen Linken zustimmend aufgenommen und Hugo Chavez galt als Hoffnungsträger für Lateinamerika. Es gibt also Potenzial für enttäuschte Hoffnungen und dergleichen. Die hiesige Debatte bildet auch die Motivation, sich mit Venezuela zu beschäftigen. Wir sollten das Thema nicht der anti-sozialistischen Propaganda in dem Sinne, dass „Sozialismus noch nie funktioniert hat, nicht im 20. und auch nicht im 21. Jahrhundert“ - überlassen.
Die Lage in Venezuela ist nicht einfach zu beurteilen. Die meisten hiesigen Medien haben sich eindeutig gegen die dortige Regierung positioniert und berichten deshalb von Haus aus voreingenommen und entsprechend negativ. Zuverlässige Berichte, Informationen und Daten sind Mangelware. Zeitweise hat sogar das Land selbst bzw. seine Institutionen die Publikation von Daten eingestellt. So auch die Zentralbank, die für einige Jahre die international üblichen Daten zu BIP, Inflation usw. nicht mehr veröffentlichte.
Trotz dieser Einschränkungen, deren man sich immer bewusst sein sollte, lässt sich einiges herausarbeiten. Zur Informationsbeschaffung für diesen Artikel wurde häufig die Internetplattform „Amerika21“1 genutzt, die unter anderem auch viele Nachrichten aus Venezuela in deutscher Übersetzung publiziert. Damit hat man Zugang zu unterschiedlichen Stimmen, inklusive von Unterstützern der chavistischen Bewegung und auch zu den Verlautbarungen der Regierung.
Allerdings bleibt die Informationslage trotzdem schwierig. Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die ökonomische Situation, denn zu den wirtschaftlichen Fakten gibt es noch die besten und einigermaßen überprüfbaren Daten.
Dagegen sind mit den gegenwärtig erhältlichen Informationen viele politischen Vorgänge kaum zu durchschauen. Das gilt einmal ziemlich allgemein für alle im Land stattfindenden Diskussionen und politischen Auseinandersetzungen. Noch stärker gilt das für die gegenwärtige Regierung und den PSUV, die die Regierung tragende Partei, mit allen eventuellen internen Richtungsstreitigkeiten bzw. Machtkämpfen. Entsprechende Einschätzungen können deshalb nur sehr zurückhaltend vorgenommen werden. Aus diesem Grund wird dieser Artikel, um es gleich vorwegzunehmen, viele wichtigen Fragen nicht beantworten können, z. B. auch die Frage nach dem tatsächlichen Wahlausgang im Juli.
Zur Vorgeschichte
Venezuela umfasst eine Fläche von etwa 912 000 Quadratkilometer, das ist gut zweieinhalb mal so groß wie Deutschland. Die knapp 32 Millionen Einwohner sind im Land ungleichmäßig verteilt. Die meisten Städte und vor allem die großen Städte liegen auf einem schmalen, bogenförmigen Landstreifen, der sich über das bergige Hinterland der karibischen Küste und die Ausläufer der Anden im Westen von Venezuela erstreckt. Die Lage in den Bergen ist kein Zufall, im tropischen Klima lebt es sich auf einer Höhenlage angenehmer. Der restliche, flächenmäßig wesentlich größere Teil des Landes ist nur dünn besiedelt. Die Landwirtschaft hat traditionell nur geringe Bedeutung und ist wenig entwickelt. Landwirtschaftlich genutzt wird etwa ein Viertel der Fläche, meistens nur extensiv für die Rinderzucht. Typischer Ackerbau spielt eine relativ kleine Rolle.
Wie bei vielen Erdöl produzierenden Ländern ist der Ölsektor auch für Venezuela von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung. Das ist im Prinzip so, seit die Ölförderung im Jahre 1917 begann. Bereits 10 Jahre später war Venezuela der größte Ölexporteur Südamerikas und nach den USA der zweitgrößte Ölproduzent weltweit. Das Ölgeschäft dominierte seitdem die Wirtschaft und generierte den Löwenanteil der Export- und auch der Staatseinnahmen. Der vergleichsweise hohe Mittelzufluss aus dem Ölsektor hatte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur. Es gab genug Devisen, um die Nachfrage mit Importwaren zu decken. Eine Produktion von Gütern für den inländischen Bedarf konnte sich unter den gegebenen Bedingungen kaum entwickeln. Das betraf nicht nur, wie bei vielen anderen Volkswirtschaften der kapitalistischen Peripherie, Investitionsgüter und technisch anspruchsvolle Industrieprodukte, sondern in großem Ausmaß auch Lebensmittel und viele andere, eher einfache Güter des täglichen Bedarfs. Folglich ist die Wirtschaft Venezuelas durch eine starke Importabhängigkeit gekennzeichnet. Solche Wirtschaftsstrukturen sind bei vielen Ländern zu finden, bei denen der Export von Rohstoffen die dominierende Rolle spielt.
Dazu gehört auch die Abhängigkeit von den Schwankungen der Rohstoffpreise, in diesem Fall für Rohöl, auf dem Weltmarkt. Mit dem Auf und Ab der Ölpreise bewegen sich gleichzeitig die Export- und die Staatseinnahmen. In den 1970er Jahren stiegen die Ölpreise mehrmals sprunghaft an (sogenannte 1. und 2. Ölkrise) und erhöhten dementsprechend die Einnahmen Venezuelas. Auch damals gelang es nicht, diese Einnahmen zu nutzen, um die Wirtschaft auf ein breiteres Fundament zu stellen. Als dann die Ölpreise etwa ab 1983 für mehrere Jahre stark fielen, führte das in Venezuela zu heftigen Krisenerscheinungen. Die Auslandsverschuldung stieg stark an, die Inflationsrate kletterte auf über 70 %, es gab eine starke Abwertung des Bolivar. Kapitalflucht, Bankenkrisen und der Staatsbankrott drohten. Es folgte eine Austeritätspolitik nach dem Muster des IWF mit Privatisierungen und Streichung von Subventionen. Die damit verbundene Verschlechterung der Lebensbedingungen löste bei der armen Bevölkerung im Februar 1989 Proteste, Hungerrevolten und Unruhen aus, den sogenannten Caracazo. Der unmittelbare Anlass waren Preiserhöhungen für den öffentlichen Verkehr. Ausgehend von Vororten der Hauptstadt, griffen die Proteste schnell auf die anderen größeren Städte des Landes über. Die die Proteste begleitenden Unruhen waren spontan und unsystematisch, aber heftig. Es kam unter anderem zu Plünderungen von Einkaufszentren. Die damalige Regierung unter dem Präsidenten Carlos Andres Perez ließ diese Aufstände gewaltsam durch den Einsatz von Polizei und Militär niederschlagen. Offiziell gab es dabei 277 Tote. Glaubhafte Schätzungen von unabhängigen Stellen nennen aber viel größere Zahlen. Es ist von 3000 bis zu 5000 Toten die Rede.
Als Spätfolgen dieser Ereignisse sind auch zwei gescheiterte Putschversuche von Teilen des Militärs zu nennen. Einer am 4. Februar 1992 unter der Führung von Hugo Chavez und der zweite am 29. November des gleichen Jahres von Offizieren, die ebenfalls Anhänger von Chavez bzw. des MBR200 waren. (MBR200 = Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, eine von Chavez anlässlich des 200. Geburtstag von Simon Bolivar (1983) gegründete Bewegung). Nach dem Putschversuch wurde Chavez inhaftiert, nach zwei Jahren aber wieder aus dem Gefängnis entlassen. Bei den im Dezember 1998 fälligen Präsidentschaftswahlen trat Hugo Chavez an und wurde mit 56,2% der Stimmen gewählt. Damit begann die Umgestaltung Venezuelas, die „bolivarische Revolution“ oder der „bolivarische Prozess“. Es wurde eine neue Verfassung ausgearbeitet, viele partizipatorischen Initiativen wurden ermutigt und gefördert, Bildungs- und Gesundheitssystem verbessert, eine Reihe von Sozialprogrammen gestartet usw.. 2008 wurde der PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela, Vereinigte sozialistische Partei Venezuelas) durch die Verschmelzung mehrerer Vorgängerorganisationen gegründet. Seitdem stellt der PSUV die Regierung.
Die ökonomischen Basis
Unmittelbar vor und nach 1998 bewegten sich die Rohölpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau (etwas unter 20 $ pro Barrel2). Danach begannen sie zu steigen, erst allmählich, etwa ab 2004 schneller. 2008 lag der Ölpreis bereits bei ca. 95 $ pro Barrel. Darauf folgte im Zuge der Finanzkrise ein Einbruch -2009 waren es nur noch ca. 60 $ -, der aber nur kurz war. 2011 wurden die 100 $ überschritten.
Während der Amtszeiten von Chavez bis zu seinem Tod 2013 (105 $ pro Barrel) ist der Ölpreis stark gestiegen und blieb (fast immer) auf hohem Niveau. Damit sind auch die Staatseinnahmen Venezuelas stark gestiegen und es bestand ein relativ großer finanzieller Spielraum. Dieser Spielraum wurde auch politisch genutzt. In Venezuela wurden viele soziale Verbesserungen umgesetzt. Alle wichtigen sozialen Indikatoren, wie Schulbesuchsquote, Ernährungsniveau und Kindersterblichkeit verbesserten sich. Die Armut wie auch der Ungleichheitsindex konnten deutlich gesenkt werden.
Spätestens 2014 begann die Trendwende. Es folgten Zeiten mit relativ starken Schwankungen des Ölpreises. 2016 und 2020 gab es Tiefpunkte mit nur noch 41 bis 42 $ pro Barrel, vorübergehend auch mal wieder Preise über 100 $, dann wieder Einbrüche. Aktuell (2024) bewegen sich die Preise zwischen 60 und 70 $. Insgesamt ist die Zeit seit 2014 von einem tendenziellen Rückgang der durchschnittlichen Rohölpreise geprägt. Für Venezuela bedeutete das sinkende Einnahmen aus dem Ölexport.
Die sinkenden Ölpreise sind aber nicht alles. Bei Venezuela gab es noch einen weiteren Grund, der zu einem Einbruch bei den Öleinnahmen führte, nämlich der mengenmäßige Rückgang der Ölproduktion. Dieser zweite Grund wog wesentlich schwerer.
In den Jahren von 1998 bis 2015 bewegte sich die Förderung von Rohöl jeweils zwischen 2,6 Millionen und 3,4 Millionen Barrel pro Tag. 2015 wurden im Durchschnitt noch 2,8 Millionen pro Tag gefördert. Danach sank die Ölförderung von Jahr zu Jahr mengenmäßig in erheblichem Ausmaß. 2020 waren es nur noch 680 000 Barrel pro Tag, also nicht einmal mehr ein Viertel der Menge von 2015. Seither hat sich die Ölförderung auf niedrigem Niveau wieder stabilisiert.
Die Einnahmen des Staates unterlagen damit einer gravierenden Einschränkung. Das ist letztlich auch die Erklärung für die anderen, in Venezuela zu beobachteten Krisensymptome. Da wären zu nennen:
Ein gravierender Mangel an Waren. Wie gesagt, Venezuela war und ist stark importabhängig. Durch den massive Rückgang der Exporteinnahmen konnten viele der früher üblichen Importe nicht mehr bezahlt werden. Als Folge verschärften sich von Jahr zu Jahr die Engpässe bei sehr vielen Waren, auch bei Waren des täglichen Bedarfs.
Der Warenmangel wurde begleitet von einer galoppierende Inflation. Die Inflationswerte waren in Venezuela schon immer vergleichsweise hoch, auch schon vor Chavez. Es gab kaum ein Jahr mit Werten unter 20 %. Aber ab 2015 erlebte das Land einen sprunghaften Anstieg der Teuerung, der alle bisher aufgetretenen Ausmaße weit hinter sich ließ. Es folgten einige Jahre mit extremer Hyperinflation. Der Höhepunkt war 2018, mit einer Inflationsrate die, laut venezolanischer Zentralbank, in diesen Jahr 130 060 Prozent betrug. Andere Quellen nennen noch höhere Inflationsraten, bis zu über 1 Million Prozent. Danach gingen die Inflationsraten zwar wieder deutlich zurück, blieben aber auf einem hohen Niveau.
Für die Bevölkerung bedeutete dies einen täglichen Kampf ums Überleben. Praktisch alles, einschließlich Nahrungsmittel und lebenswichtige Medikamente, war kaum mehr erhältlich und wenn, dann zu unerschwinglichen Preisen. Die Armutsquote stieg auf angeblich über 90 Prozent der Bevölkerung. Erscheinungen wie Unter- und Mangelernährung, die man bereits überwunden glaubte, griffen wieder um sich. Das Gesundheitssystem war am Zusammenbrechen. Viele Medikamente und alle etwas aufwändigeren Behandlungen konnten nicht mehr bereitgestellt werden. Kriminalitäts- und Mordraten erreichten neue Höhepunkte.
Unter diesen Umständen verließ ein erheblicher Teil der Einwohner das Land. Die genauen Zahlen sind umstritten. Maximal ist von bis zu 7 Millionen Menschen die Rede. Einige Millionen werden es mit Sicherheit gewesen sein, die vorübergehend oder dauerhaft ausgewandert sind.
In den letzten Jahren, etwa ab 2020, hat sich die Situation etwas beruhigt. Bei den wichtigen Kennzahlen kam es zu einer gewissen Stabilisierung. Bei der Ölförderung konnte 2024 wieder eine Steigerung auf 853 000 Barrel pro Tag erreicht werden. Die Inflationsraten sind immer noch hoch. Die genannten Zahlen sind je nach Quelle unterschiedlich, aber es besteht Übereinstimmung darin, dass die Hyperinflation überwunden ist. Die Zentralbank berichtet für 2023 von 190 % Preissteigerung, zum 1. Mai 2024 werden für die vergangenen 12 Monaten 67% genannt, bei deutlich fallender Tendenz.
Einordnung und Bewertung
Chavez hatte das Glück, dass zu seinen Amtszeiten die Einnahmen sprudelten. Sie wurden durchaus sinnvoll eingesetzt, hauptsächlich für viele soziale Verbesserungen. Was aber nicht geschah, war eine wesentliche Verbreiterung der produktiven Basis und/oder eine Rücklage für schlechtere Zeiten.
Als dann die Einnahmen immer geringer wurden, hat die Regierung nicht ihre Ausgaben reduziert, sondern versucht, die fehlenden Mittel zuerst einmal durch Gelddrucken auszugleichen. Gelddrucken bedeutete in der damaligen Situation die Ausweitung der Zentralbankgeldmenge, ohne dass diese zusätzliche Geldmenge durch Güter und Waren, die ja nicht mehr importiert werden konnten, gedeckt gewesen wäre. Da der Rückgang der Staatseinnahmen nicht begrenzt blieb, sondern sich von Jahr zu Jahr verschärfte, wurde das Gelddrucken offensichtlich immer hemmungsloser praktiziert, wie der Verlauf der Hyperinflation anzeigt. Eine Hyperinflation mit astronomischen Preissteigerungswerten wie in Venezuela in den Jahren um 2018 ist nur durch eine massive, ungedeckte Ausdehnung der Zentralbankgeldmenge erklärbar.
Gelddrucken war aber nicht das einzige, was versucht wurde, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig wurden umfangreiche Devisenkontrollen und Preisüberwachungen eingeführt. Für Bedürftige wurde ein System der direkten Verteilung von Lebensmitteln aufgebaut. Bei Verstößen gegen diese Maßnahmen wurden strenge Strafen angedroht. Es gab auch durchaus die Forderung nach einer noch weiteren Verschärfung des Klassenkampfes, z.B. von der KP (PCV = Partido Comunista de Venezuela). Denn wenn der Gegner Waren hortet, die Preise treibt usw., muss man ihn daran hindern, indem man ihm die Verfügungsgewalt über diese Dinge nimmt. Allerdings scheinen alle diese Maßnahmen nicht sehr effektiv gewesen zu sein. Auch Verstaatlichungen von Betrieben haben des öfteren dazu geführt, dass deren Produktion noch weiter gesunken, manchmal auch vollkommen zum Erliegen gekommen ist. Warum war man nicht in der Lage, Produktion und Preise wirkungsvoll zu kontrollieren ? Fehlte es an Unterstützung aus der Bevölkerung, gab es nicht genug qualifizierte Aktivisten oder schreckte man vor Konsequenzen zurück ? Die Kontrollmaßnahmen sind letztlich gescheitert. Das lässt sich als Ergebnis feststellen, auch wenn die Gründe dafür von uns nicht im einzelnen nachvollzogen und beurteilt werden können.
Ab 2018 wurden immer deutlicher Versuche erkennbar, mit anderen Mitteln die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Zu nennen wäre einmal die Einführung des „Petro“. Der Petro war eine von Venezuela entwickelten Kryptowährung, deren „Wert“ an den Preis des Öls gekoppelt sein sollte. Damit wurde versucht, einen auch international stabilen Anker für die einheimische Währung, den Bolivar, zu schaffen. Dieser Ansatz wurde aber bereits nach kurzer Zeit wieder aufgegeben und nicht mehr aktiv weiterverfolgt. Im Januar 2024 schließlich wurde der Petro ganz abgeschafft, übrigens ohne jede offizielle Begründung. Stattdessen wurde eine stillschweigende Dollarisierung zugelassen. In mehreren Schritten wurden seit 2018 die Devisenkontrollen gelockert, Dollarkonten erlaubt und elektronische Zahlungssysteme eingeführt, die Transaktionen auf Dollarbasis ermöglichen. Inzwischen scheint der Dollar de facto das eigentliche Zahlungsmittel in Venezuela zu sein. Der Bolivar ist real nur noch eine Verrechnungseinheit, die von jedermann ständig in Dollar umgerechnet wird (auch automatisch zum jeweils tagesaktuellen Kurs).
Gleichzeitig wurden neben den Devisenkontrollen auch die Preiskontrollen und andere Überwachungsmaßnahmen für die Privatwirtschaft reduziert. Es wird wieder versucht die wirtschaftliche Tätigkeit von Privaten anzuregen. Entsprechende Aussagen findet man in Reden von Ministern und von Präsident Maduro. Allerdings enthalten diese nur relativ allgemeine und vage Ausführungen und keine ausführlichen und tiefer gehenden Begründungen.
Ein weiterer Ausdruck der Wende in der Wirtschaftspolitik stellt das Einfrieren der Löhne und Renten und der Übergang zu Bonuszahlungen dar. Diese „Bonification“, wie sie genannt wird, ist eine typische Eigenheit Venezuelas. Tarifliche Lohnvereinbarungen sind ausgesetzt und der staatliche Mindestlohn ist seit März 2022 auf 130 Bolivar eingefroren, damit auch die Renten, die an den Mindestlohn gekoppelt sind. Wegen der Inflation ist aber die Kaufkraft stark gesunken und sinkt ständig weiter (die 130 Bolivar entsprachen im März 2022 etwa 30 US-Dollar, inzwischen, im Mai 2024, sind es nur noch 3,60 $). Um diesen ständigen Verlust zumindest einigermaßen auszugleichen, werden Boni und Prämien gewährt.
Konkret schaut das so aus: Der eigentliche Lohn, der sogenannte Vertragslohn, ist für die Venezolaner nur noch ein kleiner Teil des monatlich verfügbaren Einkommens, individuell ist das unterschiedlich, aber mehr als um die 5 % ist es meistens nicht. Der Lohn wird dann durch - meistens mehrere – Bonuszahlungen ergänzt. Es gibt regelmäßige Bonuszahlungen und einmalige Boni, größere (mit einen Umfang von z.B. 100 $) und kleinere mit 2,50 $ oder ähnlichen Größenordnungen pro Monat. Die Zahlung erfolgt jeweils beim Vorliegen bestimmter Bedingungen. Ergänzt werden kann das durch Sozialleistungen, manchmal auch Boni genannt - das wird nicht immer klar unterschieden -, die über das „carnet de la patria“ (Bürgerpass oder Sozialausweis) bezogen werden. Darüber können Bedürftige z.B. auch Lebensmittelpakete erhalten.
Die Situation ist unübersichtlich. Für den Beobachter aus Deutschland ist es unklar, wie vollständig die Bevölkerung vom Bonussystem erfasst wird und wer eventuell durch dieses soziale Netz fällt. Es ist kaum nachvollziehbar, wer genau warum welche Boni bekommt. Man findet dazu keine systematischen Darstellungen, nur Einzelberichte.
Für einfache Arbeiter beim Ölkonzern PDVSA wird 2023 berichtet, dass sich ihr Gesamteinkommen zwischen 100 und 200 Dollar bewegt. Stahlarbeiter kommen auf 200 $ und bis zu 80 $ Zulagen (2023). Staatlich Beschäftigte erhalten einen Bonus von 100 $, der zum 1. Mai 2024 auf 130 $ erhöht wurde. Dieser Staatsbonus gilt anscheinend auch für Rentner. Es gibt auch einen Wirtschaftskriegsbonus, der ebenfalls am 1. Mai von 60 auf 90 $ erhöht wurde. Eine Angestellte einer staatlichen Telekommunikationsfirma berichtet dagegen von einem Einkommen von nur ca. 70 $, davon 1,80 $ als Vertragslohn. Der Rest ist eine sogenannte Arbeitsplatzprämie und ein Lebensmittelpaket im Wert von 50 $. Warum sie den Staatsbonus von 100 bzw. 130 $ nicht erhält, bleibt unklar.
Die Boni werden einseitig gewährt, sie sind in keiner Weise vertraglich abgesichert. Es scheint auch eine erhebliche Dynamik zu geben. Manche Boni fallen plötzlich wieder weg und werden durch neue, aber nicht identische ersetzt oder durch die Erhöhung von anderen, bereits existierenden ausgeglichen, mal mehr, mal weniger vollständig. Dies und insbesondere einmalig gewährte Boni bringen ein erhebliches Maß an Unsicherheit mit sich.
Die mit den Boni verbundenen Geldbeträge werden auch von offizieller Seite in Dollar angekündigt. Die Auszahlung erfolgt zwar in Bolivar, die Umrechnung Dollar zu Bolivar aber zu den tagesaktuellen Wechselkursen, wodurch ein gewisser Inflationsschutz gegeben ist.
Die Boni sind erklärtermaßen nur Notfallmaßnahmen und sollen in Zukunft wieder durch ein „normales“ System ersetzt werden, d.h. mit Vertragslöhnen, die den Lebensstandard sichern, vermutlich auch wieder mit Sozialabgaben, Steuern etc.. Zur Zeit ist das aber noch nicht in Sicht.
Das „carnet de la patria“ ist auch Auslöser von Kontroversen, besonders bei oppositionell Gesinnten. Zur Kontrolle der Abgabe der Sozialleistungen werden persönliche Daten erfasst, neben Name und Adresse auch Einkommensdaten, Vereins- und Parteimitgliedschaft und Social-Media-Konten. Deshalb wird der Vorwurf erhoben, das „carnet“ diene hauptsächlich der politischen Kontrolle der Bevölkerung. Die Regierung scheue nicht einmal davor zurück, dafür auch zum Überleben notwendige Sozialleistungen einzusetzen.
Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Ursprünglich waren in Venezuela, wie in vielen anderen Ländern auch, an die Löhne Leistungen wie Urlaubsgeld, Abfindungen bei Entlassungen, Abgaben für die Rentenversicherung und manchmal auch für zusätzliche Krankenversicherungen gebunden. Formal ist das zwar immer noch so, aber die darüber bewegten Beträge sind inzwischen so winzig, dass sie eigentlich vernachlässigt werden können. Das bedeutet unter anderem, ein funktionierendes Rentensystem gibt es in Venezuela zur Zeit nicht.
Die tieferen Ursachen der ökonomischen Krise
Bei den Rohölpreisen ist die Analyse einfach. Es handelt sich um eine einseitige Abhängigkeit Venezuelas vom Weltmarkt. Die Ölproduzenten der OPEC, Venezuela ist Gründungsmitglied, versuchen zwar immer wieder die Preise in ihren Sinne zu stabilisieren, aber nur mit mäßigem Erfolg. Zu groß sind die Einflüsse der Faktoren, die die Öl produzierenden Länder nicht beeinflussen können, seien es neue Technologien bei der Förderung wie das Fracking, Nachfrageschwankungen in der Folge des weltweiten Konjunkturverlaufs oder politische Krisen mit ihren Auswirkungen auf Produktion, Transport und Nachfrage von Erdöl.
Die Ursachen des Rückgangs der Ölförderung sind schwieriger festzustellen. Offizielle venezolanische Stellen nennen als Grund für die Probleme die Sanktionen, insbesondere die der USA. Es ist vom Wirtschaftskrieg der USA gegen Venezuela die Rede. Und sie haben damit durchaus recht. Es kann nicht bestritten werden, dass die Sanktionen das Ölgeschäft und auch die sonstige Wirtschaft ganz erheblich behindern und für Venezuela ein großes Problem darstellen. Insbesondere dürfte das Land für sein exportiertes Öl nicht mehr die am Weltmarkt üblichen Preise erzielen, weil den Abnehmern, die als Sanktionsbrecher Risiken eingehen, niedrigere Preise gewährt werden müssen. Viele Sanktionen lassen sich zwar irgendwie umgehen, aber nur mit erheblichem Mehraufwand und zu hohen Kosten.
Aber die Sanktionen reichen als Erklärung nicht aus, hauptsächlich wegen des zeitlichen Ablaufs. Der Produktionseinbruch ist bereits in den Jahren 2016 und 2017 deutlich zu erkennen. Die schärferen Sanktionen wurden aber erst 2018 und besonders dann 2019 verhängt (siehe Kasten). Insgesamt ist festzustellen, dass die Sanktionen nicht die gleiche Schärfe aufweisen wie die gegen Iran oder Russland. Und es scheint so, dass andere Länder mit vergleichbaren Sanktionen besser umgehen konnten.
Sucht man nach weiteren Ursachen, stößt man auf Ereignisse aus den Jahren 2002 - 2003. In diesen Jahren gab es den sogenannten „Generalstreik“. Streik steht in Anführungszeichen, weil es sich dabei nicht um einen echten Arbeitskampf, etwa um höhere Löhne, gehandelt hat. Der Aufruf zum „Streik“ kam bezeichnender Weise gemeinsam von Unternehmensverbänden und den CTV, einem Gewerkschaftsdachverband, der mit der alten Regierung vor Chavez eng verbundenen war. Das ursprüngliche Ziel dieser Aktion war, den Rücktritt von Chavez zu erzwingen. Trotz der üblichen Bezeichnung Generalstreik war vor allem der staatliche Erdölkonzern PDVSA (Petroleos de Venzuela S.A. = Petroleum von Venezuela Aktiengesellschaft) betroffen. Dort kam es zu Arbeitsverweigerungen und Sabotageaktionen, die den Konzern zeitweise lahmlegten. Bei den „Streikenden“ soll es sich hauptsächlich um Manager, Führungskräfte und Spezialisten gehandelt haben. Es war ein Kampf um Einfluss und Macht. PDVSA war und ist bekanntlich der Schlüsselbetrieb in Venezuela. Im Verlauf dieses Konflikts wurden 18 000 Beschäftigte, von insgesamt ca. 80 000, entlassen, hauptsächlich die Träger des „Streiks“, das heißt Manager, Führungskräfte und Spezialisten. Führungskräfte wurden oft durch Militärangehörige ersetzt. Danach war die Führung des PDVSA politisch loyal, aber es ist fraglich, ob es gelang, alle Entlassenen durch ausreichend qualifiziertes Personal zu ersetzen.
PDVSA war nicht nur Objekt eines Machtkampfs, die Regierung hat den Konzern auch als vermeintlich einfache Geldquelle für alles mögliche herangezogen. Ihm wurden viele Aufgaben außerhalb des Ölgeschäfts, die eigentlich mehr Aufgaben sozialer Art waren, übertragen.
2007 wurden die ausländische Partner der PDVSA darauf verpflichtet, ihren Anteil an joint ventures (es handelte sich dabei im wesentlichen um Ölfelder, die gemeinsam ausgebeutet werden) auf maximal 40 % zu reduzieren. Die Liste mit den ausländischen Partnern enthielt die Namen fast aller großen Ölmultis. Mit einigen konnte eine Einigung erzielt werden, mit zwei der wichtigsten, nämlich ExxonMobil und ConoccoPhilips, aber nicht. Diese wurden daraufhin enteignet, was zu langandauernden Gerichtsverfahren vor internationalen Schiedsgerichten führte. Diese Konfrontation dürfte dem PDVSA aus technischen und organisatorischen Gründen, z.B. was die Sicherung von Absatzwegen betrifft, zusätzliche Schwierigkeiten bereitet haben.
Es ist davon auszugehen, dass alle diese Ereignisse dazu beigetragen haben, die Funktionsfähigkeit von PDVSA zu beeinträchtigen. Wahrscheinlich wurde die notwendige Wartung der Ölförderungsanlagen vernachlässigt und vermutlich waren die getätigten Erhaltungsinvestitionen zu gering. Sparen am Unterhalt kann für einige Zeit ohne allzu großen Folgen scheinbar funktionieren. Mit einer zeitlichen Verzögerung machen sich dann aber unweigerlich die negativen Auswirkungen bemerkbar, in diesem Fall durch einen drastischen Rückgang der Mengen des geförderten Erdöls.
Das ist auch die Einschätzung vieler Beobachter, die von Ausplünderung und Herunterwirtschaften des Ölsektors sprechen. Sicher, diese Beobachter stehen den politischen Verhältnissen in Venezuela oft ablehnend bis feindlich gegenüber. Das sollte man nicht vergessen. Aber es ist anzunehmen, dass die Einschätzungen zumindest einen realistischen Kern enthalten.
Es gibt im Zusammenhang mit der Ölförderung auch viele Gerüchte und Anschuldigungen bezüglich massiver Korruption. Erhebliche Ölmengen sollen in dunkle Kanäle abgezweigt worden sein. Von zwielichtigen Geldströmen, Scheinaufträgen an obskure Firmen und dergleichen mehr ist die Rede. Korruption in großem Ausmaß kann auch von offizieller Seite nicht grundsätzlich abgestritten werden. Es gab schließlich mehrere spektakuläre Verhaftungen aus solchen Gründen.
Von hier aus und auf Basis der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Informationen ist allerdings eine definitive Beurteilung der Vorgänge, die den Rückgang der Ölproduktion verursachten, im einzelnen nicht möglich. Über viele Punkte können wir keine wirkliche Klarheit gewinnen. Fest steht aber, die geförderten und exportierten Ölmengen sind erheblich zurückgegangen, mit der Folge eines riesigen Lochs bei den Staatseinnahmen. Auf staatlichen Leistungen beruhte aber der Erfolg des bolivarischen Wegs unter Chavez. Hauptsächlich wegen des Rückgangs der Öleinnahmen brach die materielle Basis für diesen Erfolg zusammen.
Fazit
Wir haben in Venezuela ein System, in dem die Regierung und andere wichtige Akteure wie etwa der PSUV eine ausgesprochen linke Rhetorik pflegen und in harter Konfrontation zur bürgerlichen bzw. rechten Opposition (und dem sie unterstützenden Ausland) stehen. Die Verhältnisse in Venezuela können aber nicht als sozialistisch bezeichnet werden. Das ist zur Zeit objektiv nicht zutreffend, auch wenn es ein Land mit einem großen staatlichen Sektor ist. Die tatsächliche Politik hat unter dem Druck der Krise eine wesentliche Wende vollzogen. Dabei ist nicht ganz klar, ob die Wende ausschließlich durch die Umstände erzwungen wurde, oder ob ihr auch eine politische Bedeutung, etwa für die zukünftige Entwicklung, zukommt. De facto läuft die Wirtschaft nur auf Dollarbasis. Die Privatwirtschaft wird wieder zu größeren Aktivitäten ermuntert. Viele Regulierungen sind entweder aufgehoben oder wegen der geänderten Umstände nicht mehr anwendbar. Einmal bestehende Sozialleistungen wurden durch die Hyperinflation pulverisiert. Zugespitzt könnte man sagen, dass eine sozialistisch auftretende Regierung auf einer ökonomischen Basis operiert, die inzwischen auch einem Neoliberalen wieder gefallen könnte.
Für die Zukunft steht die Überwindung des Systems der Boni an. Noch ist nicht bekannt, wann und nach welchem Plan oder gemäß welcher Kriterien das im Einzelnen geschehen soll. Dieser Prozess wird auf jeden Fall entscheidend für die zukünftigen sozialen Verhältnissen in Venezuela sein, denn es muss neu festgelegt werden, wer aus welchen Gründen welches Einkommen erzielt oder erzielen kann. Klar sichtbar ist aber bereits, dass der materielle Rahmen dafür begrenzt ist. Es gibt nicht sehr viel zu verteilen. Realistischerweise muss man davon ausgehen, dass der Lebensstandard und die sozialen Verhältnisse, wie sie vor der Krise etwa um das Jahr 2013 vorhanden waren, auf absehbare Zeit nicht wieder erreicht werden können. Dafür wäre es notwendig, die produktive Basis des Landes erheblich auszuweiten, sei es über eine Steigerung der Ölförderung oder über andere Aktivitäten.
Solche anderen Aktivitäten, die Förderung von Gold, Coltan und anderer Bodenschätze (Eisenerz, Bauxit, Kohle) oder ein Ausbau der Landwirtschaft, wurden immer wieder angekündigt. Anscheinend blieb es aber oft bei den Ankündigungen. Wenn etwas angepackt wurde, dann nur mit mäßigem Erfolg. Insgesamt scheinen die Alternativen zum Öl noch kein Ausmaß erreicht zu haben, das gesamtwirtschaftlich von größerer Bedeutung wäre, vielleicht mit Ausnahme der Goldförderung. Deren Umstände sind aber nicht sehr transparent. Denn die Goldförderung unterliegt der Kontrolle des Militärs und ihr Ertrag ist letztlich geheim.
Es ist also ein bitteres Fazit zu ziehen. Der bolivarische Prozess hat unter günstigen Rahmenbedingungen Erfolge erzielt und Verbesserungen für große Teile der Bevölkerung erreicht. Diese Erfolge konnten aber unter den folgenden, wesentlich schlechteren Bedingungen nicht behauptet und verteidigt werden.
Es gab immer schon linke Stimmen, die bezüglich der Erfolgsaussichten skeptisch waren und auf ungünstige Ausgangsbedingungen hingewiesen haben. Etwa auf die geringe Industrialisierung und die relativ kleine Arbeiterklasse. Ein sehr großer Teil der nicht privilegierten Schichten war im informellen Sektor tätig. Das sind sicher zuerst einmal nur pauschale Feststellungen. Aber es macht dann schon einen Unterschied, ob für eine Produktionskontrolle von unten ein Reservoir an Aktivisten vorhanden ist, die erfahrene Produktionsarbeiter sind, oder eben nicht. Dazu kommen die grundsätzlichen Schwierigkeiten, den Weg zum Sozialismus nur in einem Land gehen zu wollen, in einem Land, das relativ klein und praktisch vollständig vom Weltmarkt abhängig ist, in einem Land, das viele Feinde, aber nur wenig Freunde hat. Das verbündete Kuba ist ebenfalls klein und befindet sich selbst in einer Krise.
In Venezuela hat sich die Auseinandersetzung zugespitzt auf die Frontstellung Regierung gegen die (rechte) Opposition. Diese stehen sich in harter Konfrontation gegenüber. Dabei ist anscheinend das Militär eine stabile Stütze der Regierung, was bisher alle Umsturzversuche hat scheitern lassen. Auch wenn das Militär ein entscheidender Machtfaktor ist, heißt das nicht, dass es die einzige Basis der Regierung wäre. Diese dürfte in der Bevölkerung noch in erheblichem Ausmaß Unterstützung mobilisieren können, wenngleich auch deutliche Anzeichen von Frustration über die Krisenauswirkungen zu erkennen sind. Auch das administrative Vorgehen3 der Regierung gegen bisherige Bündnispartner, wie z.B. die KP, macht die vorhandenen Risse sichtbar.
Viele Fragen bleiben noch offen. Auch die einer abschließenden Einschätzung. Stark zugespitzt stellt sich die Frage: Kann der bolivarische Prozess für Venezuela noch ein Weg in eine bessere Zukunft oder gar zum Sozialismus sein, wie widersprüchlich und mühselig auch immer, oder ist er letztlich eine Sackgasse?
2Alle genannten Rohölpreise sind die von der OPEC berichteten durchschnittlichen Weltmarktpreise. Die von den einzelnen Produzenten tatsächlich erzielten Preise können davon abweichen.
3https://amerika21.de/2023/08/265370/tsj-vorstand-pc-venezuela , das oberste Gericht setzte bei der PCV einen Ad-hoc-Vorstand ein, gegen den Willen der Mehrheit in der Partei. Anlass war die Klage einer Minderheitsfraktion der PCV, die die Kritik der PCV an der Regierung (seit dem Parteikongress von 2022) nicht mitträgt.
Politische Ereignisse
Dezember 1998 Hugo Chavez wird mit 56 % der Stimmen zum Präsidenten gewählt
1999 die neue bolivarische Verfassung wird beschlossen
2002 „Streik“ bzw. Sabotage bei PDVSA, Steuerstreik der Wohlhabenden, Putschversuch
2004 Referendum zur Abwahl von Chavez, in der folgenden Abstimmung wird Chavez mit über 59% der Stimmen bestätigt
2006 Wiederwahl von Chavez mit fast 63 %
2007 ausländische Partner der PDVSA müssen ihren Anteil an joint ventures (sprich Ölfelder) auf maximal 40 % reduzieren, Einigung mit Total, Chevron, Statoil und BP, keine Einigung und deshalb Enteignung der Anteile von ExxonMobil und ConoccoPhilips
Oktober 2012 dritte Wiederwahl
März 2013 Tod von Hugo Chavez
April 2013 Nicolas Maduro wird mit 50,78% zum Präsidenten gewählt
2014 große oppositionelle Demonstrationen wegen Inflation, Warenknappheit, Kriminalität
März 2015 Obama unterzeichnet die Executive Order 13692, Beginn der Sanktionen
Dezember 2015 Wahl zur Nationalversammlung, Opposition gewinnt absolute Mehrheit
März 2016 Opposition startet mit einem Referendum zur Abberufung des Präsidenten Maduro, dieses findet letztlich nicht statt, Streit um Unterschriften und Verzögerungstaktik der Regierung
März 2017 das Oberste Gericht entzieht der (oppositionellen) Nationalversammlung die Kompetenzen, die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung wird initiiert und im Juli durchgeführt; alle diese Schritte sind stark umstritten und werden von der Opposition bekämpft
2018 Höhepunkt der Inflationsrate
März 2018 Verhaftung von Miguel Eduardo Rodriguez Torres wegen "Handlungen gegen die öffentliche Ordnung und Ruhe sowie einer Verschwörung mit dem bösartigen Ziel, diemonolithische Einheit der Bolivarischen Streitkräfte zu bedrohen". Gleichzeitig wurden 28 weitere Personen aus den Streitkräften festgenommen. Torres war ein Gefährte von Chavez, bis 2014 war er Innenminister. Beobachter vermuten, dass Torres, von einer linken Position ausgehend, die Wende in der Wirtschaftspolitik abgelehnt hat. Im Januar 2023 wurde er aus der Haft entlassen undkonnte nach Spanien ins Exil gehen.
Mai 2018 Wiederwahl von Maduro, offiziell 46 % Wahlbeteiligung und 68 % Zustimmung
Januar 2019 die (oppositionelle) Nationalversammlung erklärt die Wahl Maduros für ungültig und Juan Gaido erklärt sich zum Interimspräsidenten, was umgehend von den USA und etlichen anderen Staaten anerkannt wird, Demonstrationen und Kämpfe in Venezuela, Verschärfung der Sanktionen der USA und anderer Staaten
2020 Tiefpunkt der Erdölförderung
Mai 2020 Versuch einer Invasion
2021 auf Vermittlung von Norwegen und Mexiko Kontakte zwischen Regierung und Opposition
Ende 2022 die oppositionelle Nationalversammlung beschließt das Ende der Übergangsregierung Gaido, in der Folge weitere Gespräche Regierung/Opposition, Gespräche mit den USA, Lockerung von Sanktionen, Ölmultis beteiligen sich mit Zustimmung der USA wieder an joint ventures
April 2024 Verhaftung von Tarek El Aissami, El Aissami hatte seit 2007 mehrere Ministerposten inne, 2018 wurde er Vizepräsident und 2020 Erdölminister. Im März 2023 trat er von seinen Ämtern zurück, weil wichtige Vertraute von ihm wegen Korruption verhaftet wurden. Jetzt wird ihm selbst Korruption in großem Stil vorgeworfen (Schaden von 23 Milliarden $). Mit ihm wurden auch noch andere hochrangige Personen festgenommen. Die USA werfen ihm Verwicklung in den Drogenhandel vor und Kontakte zum mexikanischen Kartell Los Zetas, seit 2017 steht er auf der Sanktionsliste der USA.
Juli 2024 Wiederwahl von Maduro, erneute Konfrontation mit Opposition, USA verschärfen die Sanktionen wieder
Sanktionen
Bei den ersten US Sanktionen mit Bezug zu Venezuela ging es noch hauptsächlich um die Verhältnisse in Kolumbien, sie richteten sich insbesondere gegen die FARC. 2008 wurden z.B. regierungsnahe Personen aus Venezuela sanktioniert, weil ihnen vorgeworfen wurde, die FARC zu unterstützen bzw. am Drogengeschäft beteiligt zu sein.
Ab 2015 wurden weitere Sanktionen gegen venezolanische Personen verhängt, die Liste der sanktionierten Personen wird immer länger.
März 2015 Obama unterzeichnet die Executive Order (EO) 13692, die Venezuela zu einer "ungewöhnlichen und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten" erklärt. Konkret und unmittelbar sind die Folgen gering, es wird nur der US-Besitz von 7 venezolanischen Personen blockiert. Die EO ist aber die formalrechtliche Basis für viele weitere Sanktionen. Außerdem dürfte die Einstufung als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA grundsätzlich abschreckend gewirkt haben. Viele potenzielle Geschäfte mit Venezuela sind deshalb vermutlich nicht mehr zustande gekommen, obwohl sie nicht direkt sanktioniert waren. Manche Beobachter bezeichnen die EO deshalb als Beginn des Wirtschaftskrieges der USA gegen Venezuela.
Die wirklich einschneidenden Maßnahmen kommen aber erst unter Trump, 2017 und später.
August 2017 Finanzsanktionen, Verbot des Handels mit venezolanischen Bonds an US-Märkten, das sollte die Finanzierungsmöglichkeiten von PDVSA treffen
2018 und 2019 folgen einer Reihe von weiteren Sanktionen, die ziemlich umfassend sind. Das Hauptziel ist die PDVSA. Zahlungen an diese Firma werden blockiert, der Handel mit ihr verboten, ebenso werden der Gold- und Bergbausektor und Banken sanktioniert, Citgo wurde der Gaido- Regierung unterstellt
Citgo war und ist ein US-amerikanisches Tochterunternehmen der PDVSA (1986 wurden 50% erworben, 1990 die restlichen 50 %) mit drei Raffinerien und etwa 4000 Tankstellen in den USA, Umsatz um die 24 Milliarden Dollar, Bilanzgewinn (2019) 246 Millionen, seit 2019 hat Venezuela keine Zahlungen mehr von Citgo erhalten,
Seit 2018 sind venezolanische Goldbestände, die bei der Bank von England gelagert werden, durch die britische Regierung blockiert, deren Wert wird auf etwa 1,7 Milliarden Dollar geschätzt.
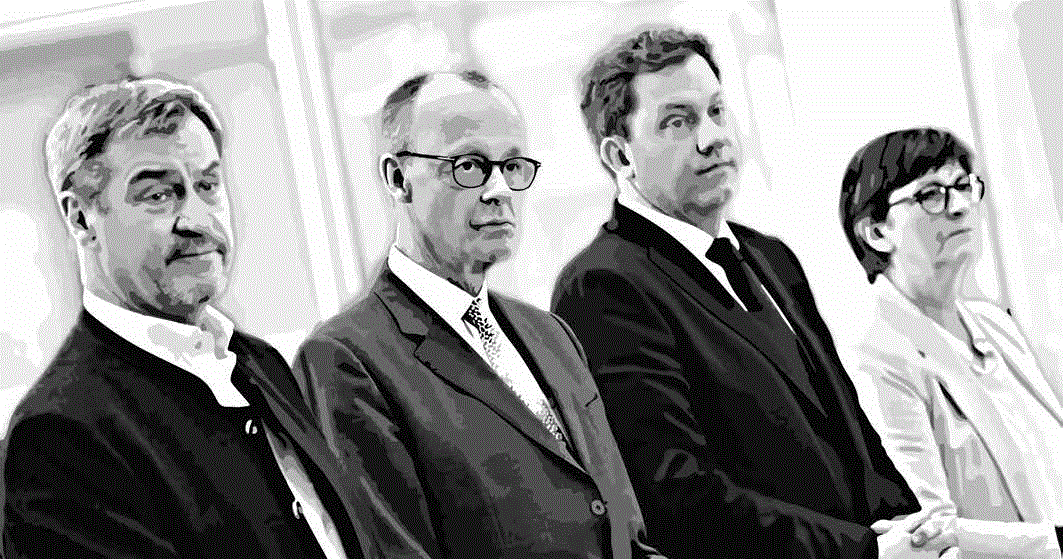
Der letzte Ausweg der „bürgerlichen Mitte“: Schwarz-Rot plus neue Schulden ohne Bremse
Knapp vier Wochen vor der Wahl hat Friedrich Merz einen Vorstoß zur Migrationsfrage gestartet. Mit Verweis auf die stattgefundenen Anschläge behauptete er, jetzt müsse sofort gehandelt werden, eine Schließung der Grenzen und die Zurückweisung aller Menschen ohne gültige Einreisepapiere sei unbedingt notwendig. Ihm sei es völlig egal, wer diesem Vorschlag zustimme, wenn nur endlich das Richtige entschlossen angepackt würde. Konkret bestand das Handeln der Unionsfraktion darin, einen Entschließungsantrag und einen bisher in den Ausschüssen behandelten Gesetzesentwurf zur Abstimmung in den Bundestag einzubringen. Der Entschließungsantrag fand mit Hilfe der Stimmen der AfD eine Mehrheit im Bundestag, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz jedoch nicht, obwohl auch hier die AfD zusammen mit den Unionsparteien stimmte. Auch FDP und BSW stimmten mehrheitlich dem Gesetz zu. Die Mehrheit im Bundestag wurde aber verfehlt, weil es aus der FDP zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen gab und 16 Abgeordnete von der FDP, 12 von CDU/CSU und drei vom BSW nicht an der Abstimmung teilnahmen. Einige Abgeordnete blieben vermutlich aus politischen Gründen der Abstimmung fern.
Nach dem Scherbenhaufen, den die Ampelkoalition hinterlassen hatte, sollte die Neuwahl des Bundestages einen Neustart in die Normalität bürgerlichen Regierungshandelns ermöglichen. Ein längerer Beitrag in diesem Heft beschäftigt sich mit den wesentlichen Aspekten der Wahl. In großer Eile begannen die Koalitionsgespräche zwischen CDU/CSU und der SPD. Noch vor der Bekanntgabe von Eckpunkten des Vertrages hatten sich die künftigen Regierungsparteien darauf verständigt, der Aufrüstungsindustrie einen Blankoscheck für alle weiteren Bedarfe auszustellen. Ohne zeitliche Befristung, ohne finanzielle Limits. Die von Merz im Wahlkampf umtanzte Schuldenbremse versenkte man über Nacht im Mülleimer der Geschichte, stattdessen wurde ein neues „Sondervermögen“ in der Höhe einer halben Billion Euro aufgelegt für „Infrastrukturmaßnahmen“. Was auch immer das bedeutet. Die GRÜNEN lassen sich kaufen, ihre Zustimmung zur Grundgesetzänderung bringt 100 Milliarden für den „Klimaschutz“. Was immer das auch bedeutet. Der alte Bundestag soll, bevor er verröchelt, noch eine Zweidrittelmehrheit für die Rekordschulden zusammenkratzen, denn die neue Sitzverteilung macht eine Grundgesetzänderung von der Zustimmung der AfD abhängig. Ob dem Kanzler in spe dies auch „völlig egal“ ist?
Der gewachsene Teil der Bevölkerung, der sich von der herrschenden Art der bürgerlichen Politik abgewandt hat, wird sich durch die zu erwartende Politik keiner anderen Meinung befleißigen, im Gegenteil.
Die Europäer und vor allem die Deutschen erleiden gegenwärtig eine massive Zeitenwende, die ihnen ihre mangelnde weltpolitische Bedeutung schmerzlich vor Augen führt. Die neue US-Administration arbeitet im Rekordtempo ihren Maßnahmenkatalog ab. Politik wird nicht mehr nach nachvollziehbaren, realen Gesichtspunkten und Erfordernissen gemacht, sondern nach persönlichen Stimmungen und Befindlichkeiten. Kriege können im Handumdrehen beendet werden, es gibt keine Verbündeten mehr, Verträge und bestehende Rechte haben keine Geltung mehr. Auf Länder, von denen sich die USA Vorteile erwarten, erhebt der Präsident Anspruch und übt gewaltigen Druck aus, um seine Sichtweise durchzusetzen . So ist eine „Riviera des Nahen Ostens“ im Gazastreifen der Nachkriegszeit vorgesehen, die palästinensischen Bewohner sollen, weil sie stören, wieder einmal vertrieben werden.
Die USA und Russland verhandeln über die Beendigung des Ukrainekrieges, gerne auch ohne Selenskyi, ohne die Ukraine und am liebsten auch ohne die Europäer. Damit ist der Angriff Russlands kein Thema mehr, die Rolle der USA und der NATO, die diese Konfrontation befeuerten, braucht nicht mehr behandelt zu werden. Dessen ungeachtet werden der Krieg und seine Folgen auf lange Zeit den Lauf der Geschichte mitbestimmen. Wir werden demnächst näher darauf eingehen.
Am 19. Dezember fand die Beisetzung unseres verstorbenen Alt-Genossen Hans Steiger in Nürnberg statt. Genossinnen und Genossen der Gruppe und befreundeter Gruppen erwiesen ihm die letzte Ehre. Ein Genosse hielt zur Würdigung von Hans und seines Wirkens eine eindrucksvolle Gedenkrede, die wir hier abdrucken. Wir bedanken uns für die Anteilnahme und Würdigung, die ihm in Zuschriften entgegengebracht worden ist. Wir werden ihn nicht vergessen und unsere Arbeit in seinem Sinn fortsetzen.
Mit dem neuen Armuts- und Reichtumsbericht von Oxfam befasst sich ein Artikel, der, über die bloßen Vermögenszahlen hinaus, die zunehmende Macht von Milliardären und ihre unmittelbaren Eingriffe in die Gesellschaften untersucht.
Der neuen weltpolitischen US-Agenda widmen wir uns in einer kurzen Glosse.
Wir veröffentlichen in dieser Nummer eine ausführliche Analyse der Situation von Venezuela, der, bereits auf der Jahreskonferenz vorgestellt, in der Winternummer keinen Platz mehr gefunden hatte.
Zur Regierungsbildung in Österreich hat ein befreundeter Genosse aus Österreich seine Gedanken in einem Artikel zusammengefasst.
Georg Aurnheimer hat uns dankenswerter Weise einen Beitrag zur Verfügung gestellt, mit dem der Umsturz der Assad-Regierung Syriens in die gewaltsamen Umbrüche des gesamten Nahen Ostens eingeordnet werden kann. Wer präzise Informationen schätzt, wird aus diesem Artikel großen Gewinn ziehen.
Unser Seminar in München findet heuer am 10.und 11. Mai statt. Anmeldungen werden gerne entgegengenommen
Wir bedanken uns bei den Leserinnen und Lesern, die uns bereits seit Beginn des neuen Jahres finanziell unterstützt haben! Wir sind dringend darauf angewiesen. Deswegen legen wir auch dieser Frühjahrsnummer einen Überweisungsträger bei und hoffen auf reichliche Zuwendungen.
IV und WKÖ scheitern mit maximaler Mehrwertabschöpfung
Nach 151 Tagen, der längsten Regierungsbildungsdauer in Österreich bisher, fand am 7. März die Regierungserklärung der neuen Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS im Parlament statt. Andy Babler (SP), Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Christian Stocker (VP) einigten sich. Was lange dauert, funktioniert nun wohl zum Zweiten. Anfang Jänner stiegen die NEOS aus eher undurchsichtigen Gründen aus den Verhandlungen aus, obwohl bereits über 80 Prozent ausverhandelt waren, weil angeblich Leuchtturmprojekte fehlten. Welche das waren, wurde nie erläutert. Massive Verschlechterungen bei Pensionen blockte die SP ab. Anschließend verhandelten VP und SP weiter, sie verfügen allerdings nur über eine Stimme Mehrheit im Parlament. Die Konservativen taten dies nur zum Schein, die Würfel waren längst gefallen. Als Vorwand für die Aufkündigung der Verhandlungen diente Bablers Forderung nach einer Bankensteuer.
Die ´Oberösterreichischen Nachrichten´ berichteten von einem Treffen der mächtigen Landeshauptleute von Oberösterreich und Salzburg mit den Spitzen der IV (Industriellenvereinigung) und der WKÖ (Wirtschaftskammer). Sie beschlossen aus den Verhandlungen auszusteigen und die Gelegenheit zu nutzen, um mit den Rechtsextremen in einer Regierung maximale Profite zu erzielen. Der bisherige Bundeskanzler und Verhandlungschef, der stets betont hatte, mit Kickl nicht zu koalieren, wurde kalt abserviert, ähnlich wie einst Mitterlehner durch die Intrigen des Sebastian Kurz.
Daraufhin beauftragte der Bundespräsident den Chef der stimmenstärksten Partei, Kickl, Koalitionsverhandlungen zu beginnen. Anfangs schien alles auf eine schnelle Einigung hinauszulaufen. Angesichts des enormen Budgetdefizits wurde kurzfristig ein knappes, vage formuliertes Schreiben nach Brüssel geschickt, um ein Defizitverfahren abzuwenden. 6 Milliarden € sollten im ersten Jahr eingespart werden, um die unsinnigen und durch nichts begründeten Maastricht-Kriterien einzuhalten. Das gelang auch. Dann zogen sich die Verhandlungen in die Länge. Ein geleaktes Verhandlungspapier zeigte eine große Menge ungelöster Probleme auf.
Einige Programmpunkte der FPÖ, die auf die Richtung Orban hinausliefen, seien erwähnt:
---- Abschaffung der ORF-Gebühr und dessen Finanzierung durch die Regierung, d.h. eine massive Einflussnahme auf die Personalentscheidungen (Stichwort: Linksfunk), verbunden mit enormen Budgetkürzungen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Feindbild Nummer 1.
---- Kürzung der Presseförderung für ´Qualitätsmedien´ bürgerlichen bis liberalen Zuschnitts (Standard, Salzburger und Oberösterreichische Nachrichten etc.), dafür die Förderung der als `alternativ` bezeichneten rechtsextremen Medien. (z.B: AUF).
---- Neue Kulturpolitik mit Auswirkungen auf progressive Kunst. Als Beispiel sei hier das jüngste Regierungsabkommen in der Steiermark zwischen FPÖ und ÖVP zitiert, das als Markstein die Förderung heimatlicher Kultur vorsieht. Daraufhin folgten dort massive Personalrochaden im Kulturbetrieb.
---- Schlagwort Festung Österreich: unmenschliche Repressivgesetze gegen Migranten, welche danach teilweise von der neuen Koalition übernommen wurden.
---- Heftiger Streitpunkt war die Beziehung zur EU, die Neutralität und das Verhältnis zur NATO.
Nach der EU-Wahl hat Kickl bekanntlich mit Orban und dem Tschechen Babiš eine eigene rechtsextrem-nationalistische EU-Fraktion gegründet. Daher waren die EU-Agenden für die Volkspartei vorgesehen.
Es ist schlimm, dass von den im Parlament vertretenen Parteien nur die FPÖ vehement für die Beibehaltung der Neutralität eintritt, wenn auch aus opportunistischen Gründen. Sie verlangte in den Verhandlungen den Austritt aus der NATO-Partnerschaft für den Frieden, keine Teilnahme an einer EU-Armee, einen Stopp der Durchfahrt für NATO-Transporter und, ganz entscheidend, keine Teilnahme am SKY-SHIELD-Projekt der NATO. Die aktive Wahrnehmung der Irland-Klausel für Neutrale wäre natürlich konsequente Neutralitätspolitik gewesen. Doch das alles waren NO GO-Perspektiven für die Volkspartei.
Es hakte noch bei weiteren Punkten, wenngleich man sich in der Flüchtlingspolitik einig war, ebenso in der Wirtschaftspolitik. Während der Verhandlungen gab es heftige Verbalattacken gegen die Konservativen und aufgedeckte neonazistische Aktivitäten von Granden der FPÖ. Das alles ließ die VP kommentarlos durchgehen. Letztlich scheiterten die Verhandlungen hauptsächlich am ausgeprägten Ego des Parteichefs der extremen Rechten und dessen Begehrlichkeiten auf das Innenministerium, in dem er bereits einmal als Minister gewütet hatte. Nicht unbegründet war die Befürchtung der VP, dass ausländische Geheimdienste, wie bereits einmal während der Amtszeit Kickls, die Zusammenarbeit einstellen würden.
Auf die Bevölkerung wären massive Belastungen zugekommen, während die Konzerne mit Erleichterungen bedient worden wären.
Erfreulicherweise ließ Kickl die Koalitionsgespräche am 12. Februar platzen.
IV und WKÖ, unterstützt vom Raiffeisen-Zentralorgan `Kurier`, waren bis zum Schluss bemüht, die Koalition doch noch zu schmieden. Die Profitmaximierung war ihnen wichtiger als die massiven Angriffe auf Demokratie, Kultur und Menschenrechte. Parallelen zu den 1930er Jahren liegen auf der Hand. Während die IV nach dem Scheitern noch Krokodilstränen vergoss, nahm die WKÖ einen Kursschwenk vor und rückte vom FP-Chef ab.
Die Burgenland - Wahl: Mitten in den Gesprächen zwischen VP und FP fanden im Burgenland Landtagswahlen statt. Die SPÖ unter Landeshauptmann Doskozil verlor zwar die absolute Mehrheit, kam aber immer noch auf 46,4% (minus 3,6%). Obwohl die beabsichtigten massiven Belastungen im künftigen Regierungsprogramm der Bevölkerung bereits bekannt waren, legte die extreme Rechte wieder deutlich zu (23,1%, plus 13,3%). Die Grünen verloren leicht und die Konservativen büßten abermals 8,6% ein. Einige Anmerkungen zur Lage im Burgenland seien noch angefügt. Dort regiert unumschränkt der Landeskaiser Doskozil. Das System lässt sich am besten als Doskonomics charakterisieren, das Land hat viele Wirtschaftsbereiche an sich gezogen, bzw. mischt in vielen maßgeblich mit. Für Landesbedienstete wurde der Mindestlohn angehoben, Schüler erhalten zu Schulbeginn Musikinstrumente usw. Man könnte fast von einem ´Landessozialismus´ sprechen. Doskozil formte zum Erstaunen vieler Kommentatoren ein Bündnis mit den Grünen. Für mich war das nicht überraschend, nachdem ich ein längeres Vorwahlinterview mit der grünen Spitzenkandidatin gehört hatte. Diese hatte an der SPÖ-Politik wenig zu kritisieren, sie forderte nur mehr Transparenz und Umweltschutz ein. Mit dem ehemaligen Bundespräsidentenkandidaten der FP, Norbert Hofer, konnte Doskozil aus persönlichen Aversionen heraus wenig anfangen, wiewohl er sonst seiner Partei eine Zusammenarbeit mit der FPÖ empfiehlt und selbst eine rigorose Ausländerpolitik vertritt. Doskozil bleibt innerhalb der Sozialdemokratie weiterhin der Quertreiber Nr. 1, er sprach der Bundespartei mehrere Male die Fähigkeit zum Regieren ab.
Nach Kickls Scheitern begannen die VP und die SP erneut mit Konsultationen, später stießen die Neos dazu. Diesmal war Eile geboten. Noch nie in der 2. Republik dauerte eine Regierungsbildung so lange. Man einigte sich jetzt rasch.
Inhaltliche Schwerpunkte des neuen Regierungsabkommens:
Alle drei Chefs betonen, im Interesse des Staatsganzen verhandelt zu haben, für das Land, für das Wohl Österreichs. Welch ein glückliches Land ohne Klassengegensätze! Vorbei sind die Attacken des ´ ´Marxisten´ Babler gegen Reiche und Konzerne.
Es ist wohl ein programmatischer Mix entstanden aus den drei Zugängen. Jede Partei hat einige Kernpunkte eingebracht. Die ÖVP eine harte Migrationspolitik, die SPÖ eine Abschwächung der sozialen Grauslichkeiten von Schwarz-Blau sowie die Besteuerung einzelner Konzerngruppen und die NEOS dürfen sich über ihr Lieblingsgebiet Bildung (Bildungsministerium) freuen.
Zur SPÖ: Positiv hervorzuheben ist die Verankerung einer Kindergrundsicherung, die Verlängerung und Erhöhung der Übergewinnsteuer für Energiegesellschaften, ferner eine moderate Bankenabgabe und eine höhere Besteuerung der Stiftungen. Grundsätzlich gut ist die Einführung eines Mietendeckels, allerdings nur für den geförderten Wohnbau und Altbauwohnungen. Der große Sektor der Privatwohnungen bleibt weiter ohne Regelung. Diese Deckelung soll bald kommen, wird betont. Wie auf diesem weit wichtigeren Sektor dann die Mieten eingefroren werden, wird sich zeigen. Die gemeinnützigen, dem Non-Profit-Sektor verpflichteten Wohnbaugenossenschaften ( sowohl von SP als auch von VP) und die Stadt Wien als riesiger Wohnbauträger übten daran heftige Kritik, weil so für die ohnehin günstigen Wohnungen (im Vergleich zum privaten Wohnbau) wenig Investitionsmöglichkeiten blieben.
Die Sozialdemokraten erhielten das äußerst einflussreiche Finanzministerium. Um dessen Besetzung gab es z.T. heftige interne Auseinandersetzungen, die der Öffentlichkeit zugespielt wurden. Andreas Babler und seine Crew konnten sich gegen die pragmatischen Wiener Genossen durchsetzen. Der Wiener Finanzstadtrat Hanke erhielt das Infrastrukturministerium. Finanzminister wurde Markus Matterbauer, der Wunschkandidat Bablers. Er ist ein äußerst kompetenter linker Ökonom, zuletzt tätig in der Arbeiterkammer Wien. Inhaltlich bezieht er sich u.a. auf Keynes und tritt für die Reichen- und Erbschaftssteuer ein. Er machte gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit der Absicht einer noch höheren Besteuerung der Stromkonzerne von sich reden, konnte diese aber nur teilweise durchsetzen. Wie sich die Zusammenarbeit mit dem marktradikalen Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer von der ÖVP als Vertreter der Großindustrie entwickeln wird, wird sich zeigen.
Die ÖVP präsentierte mit Kickl im Nacken stolz harte Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik. So soll der Familiennachzug komplett gestoppt werden, was der europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht. Ferner soll eine Art Anhaltelager für abgelehnte Asylwerber eingerichtet werden, natürlich unter Beachtung humanitärer Regeln, wie es heißt. Die Koalitionäre einigten sich auf das umstrittene Kopftuchverbot für Minderjährige, bisher ein NO GO für die SPÖ , ebenso auf den Stopp des Familiennachzugs.
Ein Kommentar in den Oberösterreichischen Nachrichten meint dazu, die SP sei in der Realität angekommen. Babler und Doskozil sind nicht mehr weit voneinander entfernt. Der linke, nach Eigendefinition ´marxistische´ Babler wird zum Realpolitiker. Die Wahrheit ist: Kickl treibt sie alle vor sich her.
Schlimmes lässt die Besetzung des Außenministeriums mit der EU-imperialen Hardlinerin Meinl-Reisinger befürchten. Für mich unverständlich, wie Andreas Babler, der einst in der für Neutralität und harte linke EU-Kritik bekannten Linzer Solidarwerkstatt mitarbeitete, dies akzeptieren konnte. Die Regierung bekennt sich nach außen zwar zur Neutralität, diese wird wahrscheinlich nicht wie bisher scheibchenweise, sondern schneller entsorgt werden. In einem versteckten Nebensatz zur Neutralität fordert man die EU zu einer imperialistischen Vorherrschaftspolitik auf. Meinl-Reisinger steht für eine EU-Armee mit österreichischer Beteiligung - das bedeutet die Aufgabe der Neutralität -, für Aufrüstung und bis vor kurzem für einen NATO-Beitritt. Die Ereignisse um Trump beflügeln jetzt die Neutralitätsentsorger in den bürgerlichen Medien. Österreich zahlt Milliarden für SKY-SHIELD und verdoppelt sein Rüstungsbudget.
Nach dem Ausscheiden der Grünen aus der Regierung spielt der Klimaschutz in dem Regierungspapier nur eine untergeordnete Rolle.
Ursprünglich waren die Sozialdemokraten, unterstützt von einigen Finanzexperten, für das Defizitverfahren durch die EU. Dies hätte einen längeren Spielraum für den Schuldenabbau bedeutet, weil die EU sowieso jedes Budget durchleuchtet. Sie konnten sich nicht durchsetzen, daher müssen heuer 6,3 Milliarden € eingespart werden. Das gewerkschaftsnahe ´Momentum Institut` kritisiert, dass Haushalte weit stärker belastet werden als die Unternehmen. Es kommt zu stark regional unterschiedlichen Belastungen für die Bevölkerung. Während die CO₂-Steuer zum 1. Jänner erneut erhöht wurde, wird der als Ausgleich gezahlte Klimabonus gestrichen, ebenso die Energiesparbremse und auch die Bildungskarenz. Für E-Autos entfällt die Befreiung von der Versicherungssteuer, für Photovoltaikanlagen die Mehrwertsteuerbefreiung. Pensionen werden generell gekürzt.
Von der Aufhebung der unter Schwarz-Blau eingeführten Verschlechterung für Werktätige (12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche) findet sich kein Wort mehr im Papier.
Es gibt Neuigkeiten von der regelbasierten Ordnung. Wir waren noch im Herbst 2024 davon ausgegangen, dass in Panama „unsere Interessen“ bereits hervorragend sichergestellt seien (Arbeiterstimme 225, S. 11). Und wenn nicht, gibt es ja noch die US-Navy ganz in der Nähe. Die deutschen Freiheitsbemühungen per Flotte dürften kaum nachgefragt werden. In Teilen sieht das der neue US-Präsident, der gleichzeitig sein eigener Nach-Nachfolger ist, erheblich anders. Die Deutschen sind aus dem Spiel, das bleibt dabei.
Neu ist, dass er den Panama-Kanal zurückhaben möchte. Denn die USA in ihrer unendlichen Güte hätten ihn Panama „geschenkt“ und Panama habe sich undankbar gezeigt: „Wir wurden … sehr schlecht behandelt.“ (Die Aussagen in Anführung sind nach dem Faktencheck der DW zitiert.) Dass die Rückgabe der Kanalzone inklusive des Kanals auf den Torrijos- Carter-Verträgen beruht, die 1977 unterzeichnet wurden und nach über zwanzig Jahren gemeinsamer Verwaltung mit dem völkerrechtlich verbindlichen Besitzwechsel zum Abschluss kamen – geschenkt. Die Fans des Völkerrechts und der regelbasierten Ordnung hierzulande nahmen die Ansagen einfach zur Kenntnis, ohne auf einem der vorgesehenen diplomatischen Kanäle angemessen zu reagieren. Die Europäische Kommission, die NATO, die deutsche Bundesregierung mitsamt der großen Völkerrechtlerin im Außenministerium schweigen und tauchen ab, bis der Präsident das nächste Schwein durchs Dorf treibt.
Dabei könnte es doch als störend empfunden werden, wenn große Mächte kleinere Nachbarn angreifen. Immerhin erregt man sich im politischen Europa seit Jahren über ein völkerrechtswidriges Verbrechen und ist solidarisch bis zur Kriegsbeteiligung.
Gut, die etwas raue Art, seine Gebietsansprüche geltend zu machen, wird als unangenehm und peinlich erlebt, aber sachlich akzeptiert das wertebasierte Europa das Anliegen durchaus. Schließlich hat sich Panama in einem „Neutralitätsvertrag“ unter anderem (im Artikel IV) verpflichtet, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika die Neutralität des Kanals zu überwachen. Was auch immer man darunter verstehen mag, die USA behalten einen Fuß in der Türe und können bei „Verstößen“ tätig werden. Diese Interventionsklausel hat bislang niemanden der Freiheitsfreunde gestört, und wenn sich jetzt der US-Präsident darauf bezieht, dann wird seine Botschaft durchaus verstanden. Im konkreten Fall gefällt ihm nicht, dass sich Panama erdreistet, die Verwaltung der Häfen mittelbar einer in Hongkong sesshaften Firma zu überantworten. „Wir haben ihn nicht an China gegeben. Wir haben ihn an Panama gegeben.“ Dass an diesen Hirngespinsten nichts dran ist, das sehen die Faktenchecker der Deutschen Welle ähnlich, aber darum geht es kaum noch. Wichtig hingegen wird genommen, dass der Einfluss Chinas in der westlichen Hemisphäre eingedämmt, wenn nicht ausgetreten werden muss.
Jenseits der Stilfragen ist man sich im EU-Europa + Großbritannien einig mit den Nordamerikanern: China muss gestoppt werden, auch wenn die Interessen eines kleinen, ressourcenfreien Landes wie Panama damit verletzt werden. Dafür ist viel Verständnis vorhanden bei den Freunden der Menschenrechte und der richtigen Ordnung.
Skurril mutete die Vorliebe des US-Präsidenten für Grönland schon während seiner ersten Amtszeit an, er möchte die Insel gerne von Dänemark übernehmen, friedlich oder – das hat sich zur Gegenwart hin geändert – eben nicht so friedlich. Das würde die Konkurrenz mit Russland um Fahrtrouten im Nordpolarmeer erheblich verschärfen und der weiteren Militarisierung arktischer Regionen Tür und Tor öffnen.
Schließlich hat Dänemark seine Besitzungen in der Karibik 1917 auch an die USA verkauft, ein Präzedenzfall wäre damit vermieden. Und, was ein Vorteil wäre: die Bewohner der Jungferninseln damals, wie die Bewohner Grönlands heute mussten und müssen nicht gefragt werden. Damals waren es die Nachfahren versklavter Afrikaner, denen bis heute keine vollständigen Staatsbürgerrechte der USA zustehen, heute sind es ein paar Zehntausend Inuit, die im Punkt Außenpolitik, Finanzpolitik und Militär nichts zu entscheiden haben. Für die Besitzübernahme spricht, dass die USA bereits über die Thule Air Base im Nordwesten der Insel verfügen. Sie wurde 2022 unter Biden nochmals ausgebaut und hat heute unter der Neubezeichnung Pituffik Space Base „Überwachungsaufgaben“, die sich auf Raketenstarts und Satelliten beziehen. Von der früher notwendigen Zwischenlandungseinrichtung über die Luftüberwachung bis zum Weltraumeinsatz sind die militärischen Fähigkeiten gestaffelt und machen die US-Exklave zu einem Hotspot gegenwärtiger und künftiger Kriegsführung.
Dagegen sind die mickrigen zwei Milliarden Euro, die eine aufgeschreckte dänische Regierung in die Hand nimmt, um die Verteidigung Grönlands auszubauen, einfach nicht angemessen. Das kann und wird dem US-Präsidenten nicht ausreichen und deshalb bleibt das Thema erhalten. Die dänische Premierministerin reist ratlos durch europäische NATO- „Partner“-Länder, um Unterstützung zu erbitten, aber gleichzeitig den Präsidenten nicht zu erzürnen. Das möchten freilich die besuchten Europäer auch nicht, deshalb werden jetzt Signale der Stärke und Geschlossenheit ausgesendet, die sich gewaschen haben. Macron ringt sich dazu durch, der Dänin ins Poesiealbum zu diktieren: „Man muss die Territorien und die Souveränität der Staaten respektieren.“ Und Scholz legt in gewohnter Manier noch eins drauf und ermannt sich, freilich ohne Grönland überhaupt zu erwähnen: „Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden.“ Um diesem Spruch beinahe eine Richtung mitzugeben, fügt er auf Englisch hinzu: „An alle, die es betrifft“. (Zitate nach DW: Grönland-Debatte, Stand: 28.01.2025) Wenn das die Dänen nicht beruhigt …
Man mag die Diskussion um den Panamakanal, um Grönland, um Kanada, um den Gaza-Streifen, um was auch immer als Possenspiel abtun, als Provokation, als Mittel, die Weltschlagzeilen zu beherrschen, oder als Strategie eines Dealers deuten.
Dahinter steht die Erkenntnis, dass die „gemeinsamen Werte“ nur der notdürftige Kitt waren, der die unterschiedlichen bis gegensätzlichen Interessen zusammenhielt, dass die wertebasierte Ordnung dazu diente, den Kuchen unter ihren Profiteuren zu verteilen. Abstrakte Werte, die vorspiegeln, alle Träger u n d Betroffene dieser Ordnung hätten davon in gleicher Weise einen Nutzen, werden zusehends eingesammelt und ausgetauscht gegen die kapitalistische Grundregel, dass der Stärkere das Recht setzt.
Es scheint gegenwärtig so zu sein, dass es eines alten, korrupten, selbstverliebten Mannes in den USA bedurfte, der allerdings auf die größten Gewaltmittel der Erde Zugriff hat, um die kapitalistischen Partner an die Rangordnung unter ihnen zu erinnern. Das politische Europa wird sich danach richten müssen.
Die Arbeiterbewegung von gestern durchlebt ihren Wandel ins Morgen
Denn der Niedergang überholter Zuordnungen wie Bindungen verlangt neue organisatorische wie aktionistische Formen, die den Emanzipationskampf aus der Lohnabhängigkeit weitertreiben, weil die soziale Lage des Verdingens der Arbeitskraft gegen Lohn zur Gewährleistung ihrer Reproduktion bislang keine dauerhafte Aufhebung erfuhr.
Die im 19. Jahrhundert u.Z. auf Basis industrieller Produktion sich durchsetzende kapitalistische Produktionsweise rief zugleich eine wachsende Arbeiterbewegung in Europa wie Nordamerika mit Konsumgenossenschaften, Gewerkschaften und Arbeiterparteien hervor.
Im direkten Gegensatz von Kapital und Arbeit, zudem auch staatlichen Institutionen als Beschäftigungssektor konnten sich seitdem Gewerkschaften mit schwankender Konflikt- somit Durchsetzungsfähigkeit bis heute behaupten. Der Zweig preisgünstiger Konsumgenossenschaften unterlag jedoch dominierender Marktmacht kapitalistischer Handelskonzerne und auch die reformistisch ausgerichteten sozialdemokratischen Arbeiterparteien erlagen ideologisch entkernt letztlich ihren Erfolgen sozialstaatlicher Absicherungen, die sie unter verringerten ökonomischen Wachstumsraten bei Rücksicht auf leichtere Verwertungsbedingungen des Kapitals nicht verstetigen können oder wollen.
Gemessen an der Zahl der weltweiten Lohnarbeit leistenden Beschäftigten sind gewerkschaftliche Zusammenschlüsse von höchstens 200 Millionen Mitgliedern aber auch nur etwa sechs Prozent von 2,9 Milliarden Lohnarbeitern. Und die Masse der gewerkschaftlich Organisierten ist zudem nach wie vor in den entwickelten kapitalistischen Metropolen vorzufinden. Gesellschaftliche Modernisierungsansätze in ökonomisch zurückgebliebenen Regionen wie Russland um 1900 oder Asien mit staatlich-planwirtschaftlicher Zielsetzung stagnierten nach Anfangserfolgen und gingen in mehr oder weniger staatlich regulierten Kapitalismus über, sodass an ihnen orientierte kommunistische Parteien in den kapitalistischen Metropolen ihren Rückhalt verloren und sich derzeit mit einer Randexistenz begnügen müssen.
Daher kann in seinem Buch „...Erkämpft das Menschenrecht“ Marcel v. d. Linden momentan konstatieren: „Der Niedergang der Arbeiterbewegung scheint fast umfassend zu sein“. Darin liegt der Wert dieser kritischen Vergegenwärtigung der Erfolge wie Niederlagen, dann aber auch heutiger eher passiven Phase einer Bewegung, die aktuell vor allem in Lohnkämpfen aufgeht und für Beschäftigungserhalt in von Schließung bedrohten Betrieben mobilisiert, nicht jedoch die „Systemfrage“ dahingehend stellt, ob die kapitalistische Produktionsweise noch eine Zukunft hat und dann welche? Ein noch relativ hoher Konsumstandard selbst bei Erwerbslosen oder Rentnern zwingt nicht zu „Visionen“.eines besseren Lebens und belässt es dabei, sich mit den Verhältnissen bei allen Unannehmlichkeiten abzufinden. „Wenn der Sozialismus überleben soll, wird er daher wohl Ansätze „von unten“ und „von oben“ kombinieren müssen, indem er Regierungspolitik, Selbstorganisation und groß angelegte Mobilisierung strategisch miteinander verbindet. Ein solcher Wandel wird sehr viel Zeit, in Anspruch nehmen.“ M. v. d. Linden /S. 207. Zusammen mit greifbaren Titeln zur Geschichte der Arbeiterbewegung (Abendroth / Sozialgeschichte d. europäischen Arbeiterbewegung, Klönne / Die deutsche Arbeiterbewegung, oder reflektiert autobiographisch Paul Elflein „Immer noch Kommunist?“ erhältlich über Arbeiterstimme) ist die Abhandlung von M. v. d. Linden bestens geeignet, gerade jüngeren Aktivisten in Gewerkschaften, Initiativen oder Parteien einen Zugang zu den wesentlichen Fragen des Klassenkampfs gestern wie heute für eine illusionslose Praxis zu eröffnen.
Auf die durchgängigen entnervenden Gender-Hinweise, auch Frauen könnten hier und da in der Arbeiterbewegung eine Rolle inhaben, sollte der Verlag im Hinblick auf Lesefluss und sozialer Kompetenz der Interessenten bei hoffentlich weiteren Auflagen des Buchtitels verzichten.
Hubert Zaremba Göttingen, 5.3.2025
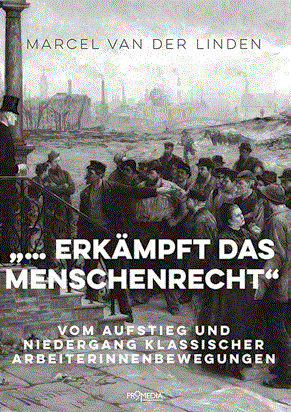
Marcel van der Linden
„... Erkämpft das Menschenrecht“
Vom Aufstieg und Niedergang klassischer Arbeiterbewegungen
2024 ProMedia-Verlag, Wien, 216 S. 25,- Euro

gehalten bei der Beerdigung unseres Genossen Hans Steiger
Werte Trauernde,
Am 15. November starb unser Genosse Hans Steiger in Nürnberg. Er war Mitgründer der Gruppe Arbeiterstimme und damit der letzte seiner Generation in unseren Reihen.
Hans hat die vielen Brüche des 20. und des beginnenden 21.Jahrhunderts in der deutschen Geschichte miterlebt. Den Faschismus, der sein junges Leben in den Jahren des Hungers und der Bomben bedrohte, und die sogenannten Wirtschaftswunderjahre, in denen die meisten Menschen von der Politik nichts mehr wissen wollten – es ging ja aufwärts, auch bei den Tätern, ohne die ein so umfassendes Menschheitsverbrechen nicht möglich gewesen wäre. Den Aufbruch der Jahre um 1968, die das Versprechen abgaben, dass eine andere Politik durchsetzbar wird, mit anderen gesellschaftlichen und persönlichen Freiheiten und einem anderen, unbelasteten Personal und die Restriktionen der späteren 1970er Jahre mit ihrer bleiernen Zeit und den Berufsverboten.
Die Verschärfung der militärischen Spannungen im Europa der 1980er und das Ende der sozialistischen Staatenwelt, inklusive der Sowjetunion.
Hans, wie uns alle in der Gruppe Arbeiterstimme, hat dieses Ende sehr getroffen, auch wenn wir dem existierenden Sozialismus stets kritisch, aber auch solidarisch gegenüberstanden. Wir wussten immer von den unzureichenden Voraussetzungen nach dem Weltkrieg, um ein antikapitalistisches System aufzubauen und waren doch erschüttert, als die Staaten nacheinander implodierten. Ich erinnere mich, dass Hans, inmitten des politischen Desasters, seiner Befriedigung Ausdruck gab, dass dieses Ende eines Staatensystems weitgehend unblutig verlief. Welchen Wert diese Tatsache hatte, mussten wir ohne weltgeschichtliche Pause zuerst außerhalb Europas, bald aber auch in Europa selbst miterleben. Den äußerst blutigen Krieg um Kuweit und die US-Invasion im Irak, die Sezessionskriege in Jugoslawien, das in blutige Stücke gerissen wurde, den NATO-Krieg gegen Serbien, in dem auch die Bundeswehr aktiv war.
Uns Jüngeren, die wir zwar die Fakten kannten, aber kein Erleben damit verbinden mussten, gelang es leichter, Distanz zu bewahren. Hans hatte es da viel schwerer, alle Kriege und Katastrophen wirkten nochmals so bedrückend, weil sie auf den Resonanzboden seiner Kindheits- und Jugenderinnerungen trafen.
Trotz alledem oder gerade deswegen: Hans war davon überzeugt, dass sich der Kampf für eine bessere, eine sozialistische Zukunft lohnen wird. Dafür trat er bereits als junger Erwachsener ein: zuerst in der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung, dann in der Arbeiterbewegung. Seine Hinwendung zum Sozialismus erfolgte in der Gruppe Arbeiterpolitik, wo er mit Genossinnen und Genossen Kontakt bekam, die seit langer Zeit politische Erfahrung hatten. Die für ihre Überzeugungen Verfolgung, Haft und Exil erleiden mussten und die ihn prägten. Er schärfte seine Überzeugungen in vielen Diskussionen und Aktionen. Mit Schulungsabenden und im Selbststudium gewann er neues Wissen und größere Sicherheit bei der Beurteilung gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen. Daraus resultierte auch seine Herangehensweise an Probleme, seine Art zu diskutieren und vor allem seine typische Zähigkeit, wenn er Ziele verfolgte.
Zu Beginn der 1970er Jahre wagte er mit einigen Genossen der alten Gruppe einen Neuanfang mit der Gruppe Arbeiterstimme, deren Mitgründer er war. Man war auseinandergegangen, weil die politischen Differenzen nicht mehr anders zu überbrücken waren. Die Aufgaben mit dem Aufbau einer neuen Stimme im linken Lager waren vielfältig und sicher sehr belastend. Neben der Festigung der eigenen Gruppe in Diskussionen und Auseinandersetzungen wollte man nach außen wirken. Die Gruppe gab eine eigene Vierteljahreszeitschrift, die gleichnamige Arbeiterstimme, heraus. Über lange Zeit prägten seine Artikel das Bild in der Öffentlichkeit. Entlastung bekam er erst, als die jüngere Generation stärker Verantwortung übernehmen konnte.
Sein über viele Jahre gewonnenes Wissen, seine unschätzbare Erfahrung und sein nimmermüder Einsatz für eine bessere, eine sozialistische Zukunft prägten unsere Gruppe nicht nur über die Jahrzehnte, sondern halfen uns, Rückschläge und Enttäuschungen, die unsere Arbeit begleiteten, zu analysieren und in produktiver Weise umzusetzen. Seine Art, den Menschen zugewandt zu sein und zu bleiben, war für uns und unsere politische Reifung essenziell. Diskussionen und Auseinandersetzungen, die in der Sache auch hart sein konnten, führten nicht zur persönlichen Verletzung. Auch wenn sich die politischen Wege trennten, konnte man sich immer noch ins Gesicht sehen. Der tiefe, gelebte Humanismus, der so stark mit seinen Kindheits- und Jugenderfahrungen im und nach dem Krieg zu tun hatte, war uns Anschauung und Vorbild zur gleichen Zeit.
Wir werden ihn nicht vergessen.

