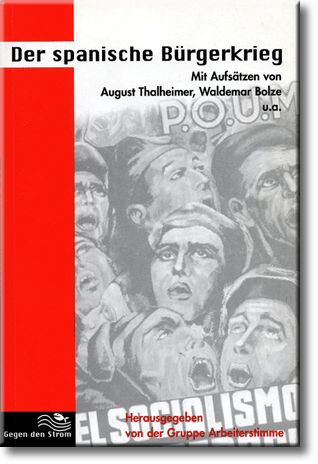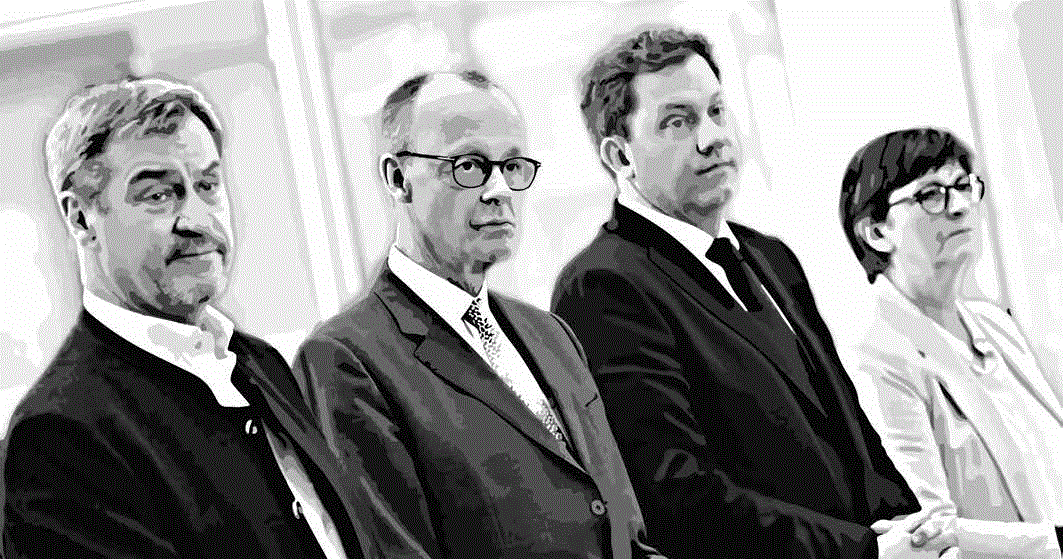Der letzte Ausweg der „bürgerlichen Mitte“: Schwarz-Rot plus neue Schulden ohne Bremse
Knapp vier Wochen vor der Wahl hat Friedrich Merz einen Vorstoß zur Migrationsfrage gestartet. Mit Verweis auf die stattgefundenen Anschläge behauptete er, jetzt müsse sofort gehandelt werden, eine Schließung der Grenzen und die Zurückweisung aller Menschen ohne gültige Einreisepapiere sei unbedingt notwendig. Ihm sei es völlig egal, wer diesem Vorschlag zustimme, wenn nur endlich das Richtige entschlossen angepackt würde. Konkret bestand das Handeln der Unionsfraktion darin, einen Entschließungsantrag und einen bisher in den Ausschüssen behandelten Gesetzesentwurf zur Abstimmung in den Bundestag einzubringen. Der Entschließungsantrag fand mit Hilfe der Stimmen der AfD eine Mehrheit im Bundestag, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz jedoch nicht, obwohl auch hier die AfD zusammen mit den Unionsparteien stimmte. Auch FDP und BSW stimmten mehrheitlich dem Gesetz zu. Die Mehrheit im Bundestag wurde aber verfehlt, weil es aus der FDP zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen gab und 16 Abgeordnete von der FDP, 12 von CDU/CSU und drei vom BSW nicht an der Abstimmung teilnahmen. Einige Abgeordnete blieben vermutlich aus politischen Gründen der Abstimmung fern.
Es ist nicht ganz klar, was Merz mit diesem Manöver erreichen wollte. Glaubte er, dadurch SPD und eventuell auch Grüne zur Zustimmung drängen zu können, um sich damit als zupackend und führungsstark, im Gegensatz zum „ständig zaudernden Scholz“, präsentieren zu können? Wollte er demonstrieren, dass die Unionsparteien auch auf der rechten Seite Mehrheiten suchen und finden könnten?
Die gleichzeitig vorgebrachten und auch danach mehrmals wiederholten Beteuerungen, nicht die Zusammenarbeit mit der AfD anzustreben, sprechen nicht für die Annahme, dass das Manöver als Beginn eines Strategiewechsels gedacht war. Aber auch als Demonstration des entschlossenen Handelns war die Vorgehensweise nicht sonderlich geeignet. Denn allen nüchternen Beobachtern war von vornherein klar, dass diese Abstimmungen keine unmittelbar realen Folgen haben würden. Bei Entschließungsanträgen ist das prinzipiell so. Entschließungen sind letztlich unverbindliche Aufforderungen an die Regierung. Dem Zustrombegrenzungsgesetz hätte neben dem Bundestag auch noch der Bundesrat zustimmen müssen, auch dort war eine Mehrheit eher unwahrscheinlich.
Auf jeden Fall hat sich Merz mit dieser Aktion selbst unter Zugzwang gesetzt. Und vor allem wurde die Migrationsfrage dadurch von einem Thema neben anderen zum beherrschenden Thema der letzten Wochen des Wahlkampfes aufgewertet. Der Tabubruch von Merz löste eine Welle der Empörung aus. Wieder demonstrierten Hunderttausende gegen Rechts, für eine offene Gesellschaft, für den Erhalt der Brandmauer und teilweise auch gegen die CDU und ihren Kandidaten.
Andererseits ist bekannt, die Aufwertung eines Themas führt häufig dazu, dass die Partei, die sozusagen die Urheberrechte dafür beansprucht, auch vom Bedeutungszuwachs und der breiten Behandlung des Themas profitiert. In diesem Fall ist das die AfD. Eine harte Begrenzung oder gar die vollständige Verhinderung der Migration ist ihr zentrales Thema, sie stellt dazu die radikalsten Forderungen. Es ist also mehr als fraglich, ob Merz durch seine Taktik wirklich bei der Wählerschaft punkten konnte. Die konkreten Auswirkungen von einzelnen Ereignissen auf das Wahlergebnis sind natürlich nicht so ohne weiteres nachvollziehbar. Aber geschadet hat es der AfD offensichtlich nicht und wirklich geholfen hat es der CDU/CSU auch nicht. Das lässt sich eindeutig feststellen.
Die Wahlergebnisse
Die Unionsparteien sind mit 28,4 % zwar die stärkste Kraft geworden, aber ein berauschendes Ergebnis ist das sicher nicht. Der Zugewinn von 4,3 Prozentpunkten ist zu relativieren, weil die Wahlen von 2021 das historisch schlechteste Ergebnis für die Unionsparteien waren. Dieser Tiefststand ist jetzt etwas korrigiert worden. Die Korrektur hat aber nur bis zum bisher zweitschlechtesten Resultat bei Bundestagswahlen gereicht. Von der großen Unbeliebtheit der Ampelregierung konnten die Unionsparteien offensichtlich nur begrenzt profitieren. Das Wahlergebnis ist kein großer Vertrauensbeweis für die CDU/CSU und für ihren Kanzlerkandidaten.
Die starke Unzufriedenheit mit der alten Regierung zeigt sich dagegen klar im Abschneiden aller daran beteiligten Parteien. Am stärksten verlor die SPD, die einen Verlust von 9,3 Prozentpunkten bzw. 3,8 Millionen Stimmen hinnehmen musste. Sie brachte es nur noch auf 16,4 %, ihr historisch schlechtestes Resultat auf Bundesebene. Der Einbruch ist auch deshalb so stark, weil sie 2021 ein vergleichsweise gutes Ergebnis erzielen konnte. Die Hoffnungen, die vielleicht 2021 noch in eine Regierung unter SPD-Führung gesetzt wurden, sind längst wieder verflogen. Jetzt dürfte der Wählerzuspruch für die SPD auf ihren Kernbestand reduziert sein.
Die FDP hat ebenfalls stark verloren und den Einzug in den Bundestag nicht mehr geschafft. Niemand aus dem linken politischen Spektrum wird das bedauern. Aber man darf die Folgen dieses Misserfolgs nicht überschätzen. Denn das Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag muss keineswegs die Schwächung der politischen Richtung, gemeinhin der Neoliberalismus, bedeuten. Gescheitert ist mit der FDP vorläufig nur eine ganz konkrete Form des neoliberalen Politangebots. Der Neoliberalismus ist hierzulande viel breiter verankert und wird auch weiterhin starken Einfluss ausüben.
Auch die Grünen haben Stimmen verloren. Im Vergleich zu 2021 waren es 3,1 Prozentpunkte oder ca. 1 Million Stimmen weniger. Aber immerhin war es noch ihr bisher zweitbestes Ergebnis bei Bundestagswahlen. Die Partei hat anscheinend eine relativ stabile Wählerbasis, vor allem im urbanen Bereich bei den „progressiven Besserverdienenden“.
Ein Gewinner der Wahl ist die AfD. Sie konnte ihr Ergebnis verdoppeln. Über 10 Millionen Menschen haben AfD gewählt, im Osten ist sie nun eindeutig stärkste Kraft.
Durch dieses Ergebnis drängt sich die Frage auf: wird die sogenannte Brandmauer halten ? Droht jetzt ein Bröckeln Schritt für Schritt oder gar ein plötzlicher Einsturz? Diese Frage wird der ständige Begleiter in der politischen Diskussion der nächsten Jahre sein.
Das BSW hat den Einzug in den Bundestag denkbar knapp verfehlt. Bei den erreichten 4,98 % (das entspricht über 2,4 Millionen Stimmen) fehlten nur 0,2 Promille (ca. 13 200 Stimmen) zu den entscheidenden 5 %.
Für eine neue Partei, die zum ersten Mal antritt, ist das eigentlich ein gutes Ergebnis. Aber das BSW hatte in Umfragen auch schon bessere Werte, die aber nicht gehalten werden konnten. War es die Art der Parteigründung „von Oben“, die sicher bei potenziellen Anhängern keinen Schwung oder gar Begeisterung für den Wahlkampf erweckte. War es der Kurs in der Migrationsfrage ? Eventuell hat die Abstimmung gemeinsam mit der AfD mehr oder weniger links orientierte Wähler abgeschreckt, ohne deshalb Wähler aus dem AfD-Umfeld gewinnen zu können. Machte sich bereits eine größere Distanz der Medien zu Sahra Wagenknecht bemerkbar ? Ein wichtiges Argument für das BSW ist die Friedensfrage. Hatten der Kurs von Trump und die entsprechenden Ereignisse kurz vor der Wahl eine Auswirkung? Die Forderung nach Diplomatie wurde mit dem Beginn der Gespräche USA-Russland zumindest oberflächlich erfüllt. Manchen dürfte auch klar geworden sein, dass die Entscheidungen, wie es in der Ukraine weitergeht, woanders gefällt werden und nicht im deutschen Bundestag. Das könnte schon eine Relativierung des Themas bei der Wahl bewirkt haben.
Noch vor ein paar Monaten, nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg lag die Partei Die Linke (DL) am Boden. In den drei Bundesländern musste sie starke Verluste hinnehmen. In Brandenburg ist sie nicht mehr im Landtag vertreten. In Sachsen blieb sie auch unter 5 % und schaffte nur durch ein Direktmandat in Leipzig den Einzug in das Parlament. Damit schien ein Erfolg bei der Bundestagswahl in weite Ferne gerückt zu sein. Das Überleben der Partei als parlamentarische Kraft, die regelmäßig, zumindest in den meisten Wahlen, die 5%-Hürde überwindet, war in Frage gestellt.
Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis in der Bundestagswahl bemerkenswert. Aber vermutlich hat gerade das schlechte Ergebnis bei den Landtagswahlen und das dadurch offensichtlich werdende drohende Ende des Projekts der Partei „Die Linke“ mit zur Wende beigetragen. Es gibt anscheinend genügend Leute, die zwar mit dem einen oder anderen Aspekt der Partei unzufrieden, unter Umständen auch stark unzufrieden sind, aber trotzdem ein Ende der Partei keinesfalls hinnehmen wollen. Schon kurz nach dem Tiefschlag im Herbst machte sich eine Welle der Solidarisierung bemerkbar. DL konnte vermehrt Parteieintritte verbuchen. Dieser Zuwachs an Mitgliedern war anscheinend nicht nur ein vorübergehendes Strohfeuer, sondern setzte sich in den folgenden Monaten fort. Besonders in den größeren Städten entschlossen sich etliche, zumeist jüngere Menschen, die Partei jetzt aktiver zu unterstützen.
Sicher gab es auch noch andere Gründe, wie etwa Stimmen von ehemaligen Wählern der Grünen und der SPD, die von der Regierungspolitik in der Ampelkoalition frustriert waren, oder von Leuten, die nach einer Zeit des Schwankens zwischen BSW und DL, sich letztlich für DL entschieden haben. Es wurde ein erfolgreicher Wahlkampf in den sozialen Medien geführt. Allen voran von Heidi Reichinnek, die auf Tiktok Star- und Kultstatus erreichte. Vielleicht haben auch Wähler von kleinen Parteien, die sonst nur unter Sonstige registriert werden, diesmal vermehrt für die DL gestimmt. Zu denken ist dabei an die Spaßgruppe „Die Partei“, die bei den vorigen Bundestagswahlen noch 1 % erhielt, diesmal aber nur 0,5 %. Bei allen diesen zusätzlichen Stimmen handelt es sich nicht um Massen, aber der mehrmalige und von verschiedenen Seiten kommende Zugewinn von je einem viertel oder einem halben Prozentpunkt summierte sich auf und ermöglichte das deutliche Überspringen der Fünfprozenthürde.
Auch der Kurs der Partei unter der neuen Führung, das Abklingen von internen Streitereien und die Konzentration auf die sozialen Fragen hat zum Erfolg beigetragen. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen und zu optimistisch sein. Die grundsätzlichen Probleme der Partei, ihre große Heterogenität und ihre unklare Haltung in etlichen Fragen bleiben weiter bestehen. Diese Probleme sind auch nicht hauptsächlich durch das Personal in der Führung und deren eventuelle Fehler begründet. Die Partei spiegelt da den Zustand ihrer Basis und dieser wiederum findet seinen Grund im Zustand und der politischen Entwicklung der gesamten Gesellschaft mit all ihren Widersprüchen und unterschiedlichen Interessen.
Koalitionen
Trotz des nur mäßigen Wahlergebnisses nehmen die Unionsparteien in Bezug auf die Regierungsbildung die Schlüsselrolle ein. Als stärkste Kraft erheben sie Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers. Ohne sie gibt es praktisch keine Mehrheit im Bundestag. Eine rechnerische Mehrheit ohne die CDU/CSU gäbe es nur bei Partei-Kombinationen, die politisch ausgeschlossen sind. Allerdings hat auch die CDU/CSU, sieht man einmal von der AfD ab, nur einen einzigen Koalitionspartner, mit dem sie eine Mehrheit der Sitze im Parlament erreicht, nämlich die SPD. Allen anderen Koalitionsvarianten fehlt entweder die Mehrheit oder sie sind politisch kaum denkbar.
Dementsprechend läuft alles in Richtung auf eine Koalition der CDU/CSU mit der SPD zu. Aber jeder weiß es und alle reden davon, eine solche Koalition wird nicht einfach werden.
Die Medien und die einschlägigen Talkshows sind jetzt voll mit Ratschlägen, was eine neue Regierung tun sollte und unbedingt vermeiden müsse. Sie sollte sich möglichst als eine Einheit präsentieren, offener Streit ist unbedingt zu vermeiden, sie muss besser kommunizieren usw.. Allenthalben wird jetzt auch betont, dass die neue Regierung nicht scheitern darf, wenn man ein noch weiteres Anwachsen der AfD verhindern will. Das ist alles nicht grundsätzlich falsch. Die letzte Regierung hat genügend Anschauungsmaterial dafür geliefert, wie man es nicht machen soll.
Ist ein Klassenkompromiss noch möglich ?
Aber solche Argumente gehen letztlich am Kern der Sache vorbei. Im Kern beruhen die politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik darauf, dass es bisher möglich war, einen Klassenkompromiss zu finden. Einen Kompromiss zwischen Kapital und Lohnabhängigen als Hauptkontrahenten, der aber auch andere Gruppen mit guten Lobbys wie etwa die Bauern einbezieht. Ein Kompromiss, der die Verteilung der Lasten in einer Weise regelt, die von Mehrheiten als einigermaßen „gerecht“ akzeptiert wird.
Solche Klassenkompromisse sind bei weitem nicht immer ausgeglichen. Die Lohnabhängigen mussten in der Vergangenheit schon einiges schlucken. Aber es liegt im Wesen eines Klassenkompromisses, dass er auch von der Gesellschaft, von den Klassen, zumindest im großen und ganzen akzeptiert wird. Die Zustimmung der Parteien zu einem Koalitionsvertrag mit Kompromissen ist damit nur die eine Seite, die deutlich sichtbar ist und über die in den Medien berichtet wird. Die zweite Seite, die gesellschaftliche Akzeptanz, wird nicht so unmittelbar sichtbar. Aber nur wenn sie prinzipiell gegeben ist, kann eine Koalitionsvereinbarung zwischen Parteien auch die Basis für eine Regierungspolitik werden, die dann von weiten Kreisen als eine erfolgreiche Politik wahrgenommen und akzeptiert wird. Ist das nicht der Fall, werden sich die abweichenden Interessen innerhalb und/oder außerhalb der Regierung artikulieren. Das bedeutet dann Dauerstreit und/oder große Unpopularität.
In den letzten Jahren hat sich die Lage der Bundesrepublik aus ökonomischen und geopolitischen Gründen verschlechtert. Für die Zukunft zeichnen sich weitere Verschärfungen ab. Das Kapital erhöht den Druck, droht mit Abwanderung und verlangt nach besseren Standortbedingungen wie Entlastungen bei Steuern und Energiepreisen, weniger Regulierungen etc., die Forderungen sind ja bekannt und werden ständig wiederholt.
Auch die Unionsparteien haben in diesem Sinne einen Politikwechsel auf vielen Gebieten angekündigt und für überfällig erklärt, vor allem wirtschaftspolitisch und in der Migrationsfrage. Dabei werden sie assistiert von einem Chor aus prominenten Ökonomen, Vertretern des Kapitals und vielen sonstigen Lobbyisten. Mit Unterstützung durch die einschlägigen Medien werden oft Vorstellungen propagiert, die über das von der Union Vertretene hinausgehen.
Die CDU/CSU will einige Gesetzte der Ampelregierung wieder rückgängig machen. Das betrifft das Gleichstellungsgesetz, genauso wie das sogenannte Heizungsgesetz und die Veränderungen beim Bürgergeld, das durch etwas Neues ersetzt werden soll. Auch sonst haben die Konservativen einiges in ihrem Wahlprogramm stehen, z.B. zu Steuererleichterungen für die Kapitalseite, was von der SPD nur schwer zu akzeptieren ist. Denn bei den von der CDU/CSU vorgeschlagenen Steuersenkungen profitieren sowieso nur die Unternehmen (bei der Körperschaftssteuer) oder Besserverdienende deutlich mehr als Kleinverdiener (bei der Lohn- und Einkommensteuer). Ganz abgesehen davon, dass sie auch das Loch bei den staatlichen Finanzen vergrößern. Um 90 bis 100 Milliarden würden die Staatseinnahmen pro Jahr geringer ausfallen, wenn diese Steuerpläne vollkommen umgesetzt würden, wie Wirtschaftsinstitute ausgerechnet haben.
Damit stellt sich die Frage, ob bei dieser Regierungsbildung noch einmal ein Klassenkompromiss möglich ist. Ob die Ansprüche des Kapitals (und der Geopolitik) erfüllt werden können, was offensichtlich das Ziel der Union ist, ohne massiv in das Gefüge des Sozialstaates, z.B. bei den Renten, einzugreifen. Klar ist, nur mit Kürzungen des Bürgergelds für sogenannte Totalverweigerer ist es nicht getan. Dazu müssen andere finanzielle Dimensionen bewegt werden (siehe dazu den Abschnitt „Finanzierungsfragen“).
Und daran schließt sich die Frage an, welche Rolle dabei die SPD spielen kann. Nicht, dass der Opportunismus der SPD anzuzweifeln wäre. Sie hat ihre Bereitschaft, die Interessen des Kapitals zu bedienen, schon vielfach unter Beweis gestellt. Aber auch ein Feigenblatt, sei es ein soziales, oder progressives oder auch nur nicht-reaktionäres (um die unterschiedlichen Erwartungen an die SPD anzusprechen), muss noch irgendwo sichtbar sein. Wenn die SPD sich nicht selbst überflüssig machen will, muss sie noch ein Mindestmaß an sozialdemokratischer Politik durchsetzen können. Nur Mitglied in einer im positiven Fall reibungslos funktionierenden Regierung zu sein, die eine neoliberale Politik und massiv steigende Rüstungsausgaben betreibt, wird der SPD nicht nützen.
Zur Zeit des Redaktionsschlusses für diesen Artikel befinden sich die Sondierungen gerade in der Endphase. Viele Details des angestrebten Regierungsprogramms sind noch nicht öffentlich. Nach derzeitiger Einschätzung ist nicht zu erwarten, dass der Klassenkompromiss Knall auf Fall aufgekündigt wird und ein Umschwenken zum harten Klassenkampf von oben erfolgt. Wahrscheinlicher sind dosierte Verschiebungen der Kompromisslinie zu Gunsten des Kapitals. Aber viele, für sich genommen kleinere Eingriffe summieren sich mit der Zeit auf und können dadurch eine qualitative Veränderung der Lage bewirken. Irgendwann ist es dann nicht mehr sinnvoll von einem Klassenkompromiss zu sprechen.
Hält die Brandmauer ?
Bis auf weiteres ist davon auszugehen, die Brandmauer wird zuerst einmal halten. Die Festlegungen und Versprechen von Merz waren dazu zu eindeutig, um sofort wieder davon abzurücken. Diese Aussagen müssen aber nicht das letzte Wort in dieser Sache bedeuten. Wichtiger für die Strategie der Union sind andere Fakten, die zur Zeit nicht für eine Umorientierung sprechen. Eine Koalition mit der AfD wäre für die Unionsparteien nicht sonderlich attraktiv, zu groß sind die Unterschiede bei vielen Themen, insbesondere bei der Außen- und Europapolitik. Vermutlich wäre die AfD auch kein einfacher Koalitionspartner. Und vor allem sind weder CDU/CSU noch die Öffentlichkeit auf einen Kurswechsel vorbereitet.
Allerdings heißt das nicht, dass die Verweigerung einer Zusammenarbeit notwendigerweise auf lange Frist oder auch nur für die ganze Legislaturperiode gilt. Sollten sich bei der Koalition mit der SPD, aus welchen Gründen auch immer, erhebliche Schwierigkeiten ergeben und/oder gleichzeitig das internationale Umfeld eine weitere Bewegung nach rechts begünstigen, wäre eine Neubewertung dieser Frage durchaus denkbar. Selbstverständlich wäre eine solche Wendung für die CDU/CSU nicht ganz einfach. Eine Aufgabe der Brandmauer könnte durchaus auch für sie zu einer internen Zerreißprobe führen, unter Umständen mit noch gar nicht abzuschätzenden Folgen. Aber auf die Dauer kann eine Umorientierung keinesfalls ausgeschlossen werden. Man darf sich durch die scheinbar starken Sprüche und Versprechungen zur Zeit nicht täuschen lassen. Die letzten Wochen des Wahlkampfs bei der Behandlung der Migrationsfrage haben einen Vorgeschmack gegeben,
Langfristige Aufgaben
Die Bundestagswahlen haben den bestehenden Trend nach rechts bestätigt. Mehr als die Hälfte der Wähler hat die Stimme für eine konservativ-rechte Partei (Union) oder für eine ausgesprochen rechte Partei (AfD) abgegeben. Bekanntlich ist ein solcher Trend nach rechts nicht auf Deutschland beschränkt, sondern zeigt sich in diversen landesspezifischen Varianten in vielen Ländern.
Bei den Wahlen war zwar auch auf der linken Seite des politischen Spektrums eine gewisse Belebung festzustellen. Aber diese Belebung zeichnet sich dadurch aus, dass eine wesentliche gesellschaftliche Gruppe dabei kaum eine Rolle spielt, nämlich die Mehrheit der Lohnabhängigen, oder, mit anderen Worten, die Arbeiterklasse. Durch die Wahlen wurde (wieder) verdeutlicht, die Stimmen der Arbeiter:innen (diese sind bekanntlich nicht die ganze Arbeiterklasse, aber der Kern) verteilen sich auf mehrere Parteien. Die AfD erhält dabei den größten Anteil, anscheinend auch bei Gewerkschaftsmitgliedern. Nur eine Minderheit der Arbeiter:innen hat DL oder BSW gewählt.
Die Lage der Lohnabhängigen ist sehr stark differenziert. Das betrifft die Situation am Arbeitsplatz, also die Bezahlung, Art der Arbeit, Kontakte und Beziehungen zu anderen Beschäftigten, Qualifikation und Ausbildung usw., ebenso wie die sonstigen Lebensumstände. Typische Arbeiter-Milieus, die eine relative Einheitlichkeit der Lebenslage bedingen, gibt es praktisch nicht mehr. Damit hat sich auch innerhalb der Klasse die Einheitlichkeit der jeweiligen Erfahrungen stark reduziert. Entsprechend differenziert sind die politischen Reaktionen auf die oft individualisierten Erfahrungen. Mit anderen Worten, ein gemeinsames Klassenbewusstsein ist nur gering ausgeprägt und bei Teilen der Klassenangehörigen fehlt es praktisch völlig.
Dementsprechend ist das Wahlverhalten der Arbeiterklasse zersplittert. Nicht selten ist es von Orientierungslosigkeit geprägt, auch von unrealistischen Erwartungen und Hoffnungen und von der Bereitschaft, sich auf falsche oder zumindest problematische Erklärungen einzulassen.
Für Marxisten findet Politik nicht hauptsächlich oder gar ausschließlich in den Parlamenten statt. Eine zu starke Fixierung auf diesen Teil des Politikbetriebs wäre fatal. Die anstehende Hauptaufgabe ist es nicht, einen Wahlkampf nach dem anderen zu führen.
Langfristig wichtiger ist es, an der Basis zu arbeiten. Dort ist an den vorhandenen und sich immer wieder reproduzierenden Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft anzuknüpfen. Es gilt, die konkreten Ansätze zur Durchsetzung der Interessen der Lohnabhängigen z.B. in den Gewerkschaften zu unterstützen und diese Aktivitäten mit der Kritik an den kapitalistischen Ursachen der Widersprüche zu verknüpfen.
Bei der gegebenen Ausgangslage sind dabei keine schnellen Erfolge zu erwarten. Eine dynamische Zuspitzung von Kämpfen ist zwar nie gänzlich ausgeschlossen, aber besonders wahrscheinlich ist sie gegenwärtig nicht. Es gilt also bis auf weiteres, Kleinarbeit zu leisten und damit mitzuhelfen, dass eine antikapitalistischen Opposition, die auch und vor allem in der Arbeiterklasse verankert ist, entstehen kann.
Stand: 07.03.2025
Finanzierungsfragen
Wie fast immer sind finanzielle Fragen entscheidend für die Umsetzbarkeit der Ziele einer Regierung. Auf einige momentan besonders wichtigen Punkte soll etwas genauer eingegangen werden.
Investitionsbedarf bei Infrastruktur
Die vorhandene Infrastruktur wurde in der Vergangenheit kaputt gespart. Das IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, gewerkschaftsnah) hat z.B. in einer Studie, die im Januar 2025 veröffentlicht wurde, einen zusätzlichen Investitionsbedarf von 600 Milliarden bis 2035 (also etwa 60 Milliarden pro Jahr) ermittelt. Die Summe bezieht sich auf alle öffentlichen Investitionen, auch die der Länder und Kommunen und nicht nur auf den Bundeshaushalt. Die öffentlichen Gesamtinvestitionen lagen 2024 in der Größenordnung von 100 Milliarden, der Anteil des Bundes (ohne Sondereffekte durch eine Kapitalerhöhung für die Bahn) bei 53 Milliarden. Nach den Vorstellungen des IMK sollten die öffentlichen Investitionen von 2025 an für etwa 10 Jahre auf 150 bis 160 Milliarden steigen. Dadurch soll das in der Vergangenheit aufgelaufene Investitionsdefizit abgebaut werden. Andere Untersuchungen nennen im Detail andere Summen, aber im Prinzip ähnliche Größenordnungen. Es gibt keine verbindlichen Festlegungen, was im Detail alles zur (öffentlichen) Infrastruktur zu zählen ist. Das wird manchmal relativ eng ausgelegt und umfasst dann nur den Kernbereich, manchmal deutlich breiter und umfassender. Wegen solcher Unterschiede sind die in unterschiedlichen Studien genannten Summen für den Investitionsbedarf oft nicht so ohne weiteres zu vergleichen. Prinzipiell ist ein erheblicher Bedarf an Investitionen inzwischen weitgehend Konsens. Es ist schwer vorstellbar, dass der Infrastrukturbereich in Zukunft ähnlich vernachlässigt wird wie in den letzten Jahrzehnten. Das würde auch den Interessen des Kapitals massiv widersprechen. Deutliche Mehrausgaben im Vergleich zu den vergangenen Haushaltsjahren erscheinen zwingend.
Klimatransformation
Die notwendigen Investitionen für die Klimatransformation könnten auch unter Infrastruktur eingeordnet werden.Sie werden extra angesprochen, weil sich hier bei den Koalitionsverhandlungen größere Differenzen zeigen könnten.
Die Union scheint in diesem Bereich ein generelles Kürzertreten anzustreben. Sie sieht, bezogen auf die vergangenen Haushalte, ein erhebliches Kürzungspotenzial bei vorgesehenen Subventionen und hat entsprechende Einsparungen als Gegenfinanzierung für ihre anderen Ziele eingeplant. Außerdem könnten technische Vorgaben und Normen, unter dem Schlagwort Bürokratieabbau, reduziert werden.
Wenn aber sowohl einschlägige Vorschriften zurückgebaut als auch finanzielle Unterstützungen gestrichen werden, wird in Sachen Klimatransformation nur noch wenig vorangehen. Mit der logischen Folge, das Erreichen der selbst gesetzten Klimaziele wird noch unwahrscheinlicher. Und da der Klimawandel in der Realität weiter voranschreitet, würde sich, wenn viele Maßnahmen einfach in die Zukunft verschoben werden, ein neuer Investitionsstau aufbauen, der noch gigantischer werden könnte als der jetzige bei Bahn, etc..
Militärausgaben
Die potenziellen Koalitionspartner haben sich eindeutig auf deutlich höheren Militärausgaben festgelegt. Auch das internationale Umfeld übt Druck (Trump: Europa soll mehr zahlen) in dieser Richtung aus. Auch wenn man diesen Kurs für falsch hält, ist es realistisch, davon auszugehen, dass in der kommenden Legislaturperiode der Wehretat substanziell angehoben wird. Offen ist allein das Ausmaß der Erhöhung, aber 50 bis 60 Milliarden pro Jahr als zusätzlicher Aufschlag zu den etwa 56 Milliarden des Jahres 2024 werden es nach den bisherigen Verlautbarungen schon sein. Das ist eher vorsichtig geschätzt und liegt noch unter 3% des BIP (das wären ca. 129 Milliarden bezogen auf die 4,3 Billionen des BIP von 2024) und weit entfernt von den von Trump genannten 5% des BIP, was für Deutschland ca. 215 Milliarden wären.
Es gibt noch andere Themen, bei denen eigentlich ein dringender Handlungsbedarf besteht, etwa, um nur eines zu erwähnen, der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Ballungszentren. Bei diesem Problem halten sich alle potenziellen Koalitionspartner in ihren Wahlprogrammen auffallend zurück. Vermutlich wird es kaum Initiativen geben, die die Situation wirklich entspannen könnten.
Der genannte Finanzbedarf ist vor dem Hintergrund einer stagnierenden oder leicht rückläufigen Wirtschaft zu sehen. Da das Wirtschaftswachstum vorerst fehlt, sind quasi automatisch von Jahr zu Jahr steigende Steuereinnahmen nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die Lage könnte sich noch weiter verschlechtern. Zu denken ist dabei an die Schwierigkeiten der Autoindustrie und ihrer Zulieferer oder an eventuell drohende Zollbarrieren und Handelskriege. Im Rahmen dieses Artikels kann nicht ausführlicher auf diese Fragen eingegangen werden. Eine schwere Krise des bisherigen Wirtschaftsmodells Deutschland (Automobilindustrie und Export) ist aber nicht mehr auszuschließen.
Nachtrag
Bereits kurz nach dem Beginn der Sondierungen haben CDU/CSU und SPD ein Ergebnis ihrer Verhandlungen präsentiert, dem eine erhebliche Bedeutung nicht abzusprechen ist.
Für Rüstungsausgaben, die über 1% des BIP hinausgehen, wird die Schuldenbremse aufgehoben. Für 2024 z.B. hätte diese 1%-Grenze bei 43 Milliarden gelegen. Damit hätten die ersten 43 Milliarden des Wehretat direkt aus Steuermitteln finanziert werden müssen. Alle Rüstungsausgaben darüber hinaus hätten ohne jede Beschränkung durch ein Neuverschuldungshindernis bestritten werden können. Damit sind auch Verdoppelungen, Verdreifachungen oder noch mehr durch einfachen Haushaltsbeschluss möglich, ohne mit irgendwelchen Schuldenbremsen zu kollidieren. Die neue Regelung soll in die Verfassung aufgenommen werden und dauerhaft gelten.
Ebenfalls durch Verfassungsänderung wird ein neues Sondervermögen von 500 Milliarden € geschaffen, das in den folgenden zehn Jahren für Investitionen in die Infrastruktur verwendet werden soll. Das heißt, der Staat wird ermächtigt, einmalig bis zu 500 Milliarden zusätzliche Schulden aufzunehmen, ohne dass dies auf die Schuldenbremse angerechnet würde. Der Betrag von 500 Milliarden ist zweckgebunden. Was dabei genau zur Infrastruktur gerechnet, bzw. was eventuell ausgeschlossen wird, ist noch nicht klar festgelegt bzw. noch nicht veröffentlicht.
Den Bundesländern soll ein Spielraum bei der Neuverschuldung zugestanden werden, der dem Spielraum des Bundes entspricht. Das heißt, auch die Länder können dann jährlich bis zu 0,35 % ihres BIP an neuen Krediten aufnehmen. Bisher galt ein Verbot der Neuverschuldung. Auch für diese Regelung muss die Verfassung geändert werden.
Alle Verfassungsänderungen sollen noch vom alten Bundestag beschlossen werden, also noch vor dem 24. 03.2025. Denn zu diesem Datum muss sich der neue Bundestag spätestens konstituieren.
Dieser Vorschlag würde, wenn er denn wirklich so beschlossen wird, die Finanzierungsprobleme weitgehend lösen. Er wäre sozusagen der finanzielle Befreiungsschlag der kommenden Bundesregierung. Sie könnte dann alle geplanten und absehbaren Ausgaben durch einfache Haushaltsgesetze regeln.
Bei diesen Vorschlag sind aber auch noch einige andere Tatsachen bemerkenswert.
Einmal, wie schnell ein Umdenken in der Politik möglich ist. Im Wahlkampf wurde die Schuldenbremse von den Unionsparteien und allen ihren prominenten Vertretern noch unisono hochgehalten. Jeglicher außergewöhnliche Finanzbedarf wurde bestritten, alles sei durch Einsparungen, Umschichtungen und zukünftiges Wirtschaftswachstum finanzierbar. Acht Tage später schaut alles anders aus und es wird ein radikales „was kümmert mich mein Geschwätz von gestern“ praktiziert.
Die anvisierte, aber noch gar nicht existierende neue Regierung lässt sich die finanzielle Basis für ihr zukünftiges Wirken im Eilverfahren vom alten Bundestag schaffen, weil sie im eben erst gewählten neuen Bundestag, der den neuen Bundeskanzler und damit indirekt auch die ganze Regierung später wählen soll, wahrscheinlich/eventuell dafür keine notwendige Mehrheit finden würde.
Es ist davon auszugehen, dass der entscheidende Grund für das Umdenken der politische Wille zum Hochfahren der Rüstungsausgaben war. Aufrüstung hat jetzt Priorität, sie soll in Zukunft von keiner Schuldenbremse mehr behindert werden. Das Sondervermögen für die Infrastruktur ist sozusagen die Zugabe, vielleicht für die SPD (und die Grünen, die ja auch zustimmen müssen) oder um das Ganze nicht zu einseitig aussehen zu lassen.
Auch wer nie ein Freund der Schuldenbremse war und mit guten Argumenten immer auf deren problematische Folgen ( wie z.B. den Investitionsstau bei der Infrastruktur) hingewiesen hat, muss, wenn er sich nicht selbst belügen will, zur Kenntnis nehmen: Diese Argumente haben nichts zum finanzpolitischen Umschwung beigetragen. Dominiert wurde die Entscheidung von Machtpolitik im internationalen Maßstab.
Die Vorgehensweise der zukünftigen Koalitionäre beinhaltet aber auch ein politische Risiko. Unmut über die umgehende Beerdigung der Schuldenbremse ist innerhalb der CDU/CSU und vermutlich auch bei etlichen Wählern durchaus vorhanden. Das Durchziehen der Verfassungsänderungen mit Abstimmung noch im alten Bundestag wird vielfach als undemokratisch und als (schmutziger) Trick wahrgenommen.
Kein besonders guter Start für eine Regierung.