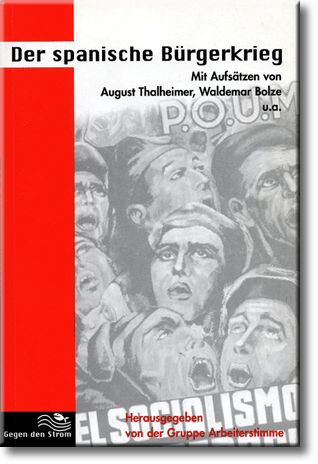In der jüngeren Vergangenheit hat die ARSTI sich relativ wenig mit der EU und den damit zusammenhängenden Fragen befasst, dies gilt es nachzuholen. Ein Beitrag in diesem Heft bringt eine Darstellung der Entstehung und eine Analyse der wichtigsten Charakteristika der EU. Ein zweiter Beitrag (in Heft Nr. 205) diskutiert die von linker Seite vorgeschlagenen Strategien für den Umgang mit der EU und legt zu dieser Frage eigene Eckpunkte vor.
Das Thema EU ist sehr vielschichtig. In den zwei Artikeln können nicht alle damit zusammenhängenden Aspekte ausführlich dargestellt werden. Einige wichtige Punkte werden nur sehr kurz angesprochen. Im Text wird jeweils auf solche Lücken in der Darstellung hingewiesen.
Vorgeschichte, frühe utopische Konzepte und Ideen
Wenn man so will, hat die EU eine lange Vorgeschichte. Erste Vorschläge für ein vereintes Europa gehen bis auf das 17. Jahrhundert zurück. Verschiedene Autoren haben dazu meist vage Ideen vorgelegt. Das Hauptmotiv dieser Autoren war der Wunsch einen dauerhaften Frieden in Europa zu sichern.
Auch in der Arbeiterbewegung wurde bereits vor dem 1. Weltkrieg über ein vereintes Europa diskutiert. Während des Krieges, auf der Zimmerwalder Konferenz von 1915, lag ein von Trotzki mitverfasstes Manifest vor, das die Notwendigkeit der „Vereinigten Staaten von Europa“ begründete. (Lenin und Luxemburg äußerten sich übrigens kritisch zu solchen Vorstellungen.)
Nach dem 1. Weltkrieg wurde die Konzepte dann etwas konkreter. Graf von Coudenhove-Kalergi, ein Adeliger aus Österreich, veröffentlichte 1924 das „paneuropäische Manifest“ und gründete die Paneuropa Union. Diese Paneuropa Union gibt es auch heute noch. Sie ist jetzt ziemlich weit rechts verortet, damals, also 1924, wurde sie aber vom eher fortschrittlichen Bürgertum, von Liberalen und auch von einigen Linken unterstützt. Ein Unterstützer war auch Aristide Briand, der mehrmaligen französische Ministerpräsident und Außenminister, der selbst 1930 eine Denkschrift „Über die Errichtung einer Europäischen Union“, wie der übersetzte Titel lautet, veröffentlichte.
In ihrem Heidelberger Programm von 1925 schrieb die SPD: „Sie“, also die SPD, „tritt ein für die aus wirtschaftlichen Ursachen zwingend gewordene Schaffung der europäischen Wirtschaftseinheit, für die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa, um damit zur Interessensolidarität der Völker aller Kontinente zu gelangen.“ Dieser Satz, ohne weitere Ausführungen und Erklärungen, findet sich im Abschnitt „Internationale Politik“, neben 6 weiteren Forderungen z.B. zur Abrüstung, gegen koloniale Ausbeutung und Demokratisierung des Völkerbunds.
Zusammenfassend kann man feststellen. Es existierten diverse Ideen über einen Zusammenschluss in Europa. Solche Vorstellungen speisten sich aus mehren Quellen und fanden in verschiedenen Gesellschaftsschichten und bei verschiedenen politischen Richtungen eine gewisse Anerkennung und Zustimmung. Realpolitik war es aber nicht.
Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg
Das änderte sich nach dem 2. Weltkrieg. Bereits kurz nach Beendigung des Krieges gab es entsprechende Aktivitäten. Am bekanntesten davon ist vielleicht die Rede von Winston Churchill (er war damals nicht Ministerpräsident sondern Oppositionsführer) am 19. September 1946 an der Universität in Zürich, in der er von den „United States of Europe“ sprach, die anzustreben seien. Es wurden mehrere Vereinigungen gegründet die sich diesem Ziel widmeten z.B. die „Union der Europäischen Föderalisten“ 1946, oder die „Europäisches Bewegung International“, 1948. Eine weitere, wichtige Organisation war das „American Committee for a United Europe“ (Amerikanisches Komitee für ein vereintes Europa, ACUE). Es wurde 1948 gegründet und war bis in die 60ger Jahre aktiv. Bei der Gründung wirkte Coudenhove-Kalergi als Ratgeber mit. Geschäftsführer des ACUE war William J. Donovan, ein ehemaliger Geheimdienstler und sein Stellvertreter kein geringere als der damalige CIA Chef Allen Welsh Dulles (der Bruder des US Außenminister John Foster Dulles). Die ACUE wurde aus US-Haushaltsmitteln finanziert, daneben auch vom amerikanischen Kapital (z.B. Rockefeller Stiftung). Man muss keiner Verschwörungstheorie anhängen, um dieser Organisation einen erheblichen Einfluss als Anreger, Koordinator und besonders als Quelle von finanziellen Mitteln zuzusprechen. Finanziell unterstützt (und beraten) wurde zum Beispiel die „Union Europäischer Föderalisten“ an der auch Robert Schuman und Paul-Henri Spaak führend beteiligt waren. 1948 fand in Den Haag die erste „European Conference on Federation“ unter dem Vorsitz Winston Churchills statt. An der Konferenz nahmen Parlamentarier aus den 16 Staaten teil, die Empfänger des Marshallplans waren. Von der Konferenz ging die Gründung des Europarat (1949) aus und man arbeitet bereits am Entwurf einer Verfassung für die „Vereinigten Staaten von Europa“.
In der Realität ging es dann doch nicht ganz so schnell mit den Vereinigten Staaten von Europa, aber es kam bald zu konkreten Schritten mit der Gründung der Montanunion und dann der EWG (für Details siehe Kasten).
Damit war die Situation eine völlig andere als die vor dem Krieg. Vor dem Krieg fanden die Befürworter einer europäischen Einigung keinen Zugang zur praktischen Politik. Jetzt wurde dieses Thema ein Teil der Realpolitik. Das bedarf einer Erklärung. Die weltpolitischen Situation hatte sich fundamental geändert. Mit der sich immer deutlicher und im Zeitverlauf immer schneller herausbildende Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion formierten sich neue Bündnisse und Blöcke. Die USA, als neue Führungsmacht, formulierten ihre Ziele für den unter ihren Einfluss stehenden Teil Europas: Wiederaufbau nach den Zerstörungen des Krieges und Stabilisierung der Verhältnisse im Sinne der westlichen, antikommunistischen Blockbildung. Zur Förderung des Wiederaufbau diente der Marshallplan. Die Gelder des Marshallplan waren mit der Forderung nach Ausbau einer europäischen Kooperation und der Förderung des freien Handel verbunden. Bald spielte in diesen Plänen die Einbeziehung Deutschlands eine wichtige Rolle. Einbeziehung war dabei auch unlösbar mit dem Ziel der Kontrolle durch Einbindung verknüpft.
Von Anfang war die Frage der wirtschaftlichen Kooperation eng mit der militärischen Zusammenarbeit verbunden. Nach dem Scheitern der EVG und der dann folgenden Wiederbewaffnung der BRD im Rahmen ihrer Aufnahme in die NATO, hat sich die bis heute im wesentlichen erhaltene Arbeitsteilung in EWG, EG, EU als hauptsächlich wirtschaftliche und zivile Veranstaltung und NATO, zuständig fürs militärische, herausgebildet.
Obwohl ständig von den „Vereinigten Staaten von Europa“, von europäischer Zusammenarbeit und ähnlichem die Rede war, führte die zunehmende Konfrontation im Kalten Krieg in der Realität zu einer Teilung Europas. Dazu gehörte auch die Entscheidung der BRD für die klare „Westorientierung“ und das Nichteingehen auf ein eventuell vereintes, aber neutrales und vielleicht auch nicht eindeutig kapitalistisches Deutschland. Die Einbeziehung der BRD in und die Nutzung ihrer Ressourcen für die westlichen wirtschaftlichen und militärischen Bündnisse ist ein ganz wesentliches Moment der Nachkriegsordnung.
Die Propaganda für die europäischen Zusammenarbeit, für ein vereintes Europa war ein Teil des ideologischen Überbaus und diente zur Verfestigung des westlichen, antikommunistischen Blocks. Dabei wurde bewusst an die utopischen Vorstellungen der Vorkriegszeit angeknüpft und auf ein nicht kompromittiertes Ziel hin orientiert. Das Vereinte Europa war die freundlich und fortschrittlich klingende Vision, der gemeinsame Markt sollte die Basis für die weitere kapitalistische Entwicklung sein.
Praktisch alle führenden Politiker haben relativ schnell diese Linie akzeptiert. Ein Konsens der länder-übergreifend und auch parteienübergreifend war (bei den westlich, bürgerlichen, antikommunistischen Parteien). Bei allen Unterschieden, die bei sonstigen Themen bestanden und natürlich auch zu Einzelheiten in der Europa-Frage, bestand Einigkeit über das Ziel einer Öffnung der Märkte und darüber hinaus einer engen staatlichen Zusammenarbeit. Dieser Konsens wurde von der eindeutig dominierenden Führungsmacht USA angeregt, unterstützt und orchestriert. Europa, als eventuell konkurrierender Block zu den USA, stand damals überhaupt nicht zur Debatte und wäre auch völlig unrealistisch gewesen.
Als entscheidend für die weitere Entwicklung der Nachkriegszeit muss man den starken wirtschaftlichen Aufschwung, der spätestens mit den 50er Jahren einsetzte, betrachten. Die Prosperität des Kapitalismus im Zuge des Nachkriegsbooms ermöglichte eine weite Verbreitung von Massenwohlstand und damit eine Stabilisierung des Nachkriegssystem. Die allmähliche Etablierung eines gemeinsamen Marktes hat sicher die kapitalistische Prosperität unterstützt. Aber die wichtigste Ursache dafür liegt nicht in der europäischen Zusammenarbeit und deren Institutionen. Es gab ja nicht nur das deutsche „Wirtschaftswunder“, sondern auch ein österreichisches (war damals nicht in der EWG) und z.B. auch ein spanisches „Milagro Espanol“ (spanisches Wunder, damals auch nicht in der EWG) und mehr oder weniger vergleichbare Entwicklungen außerhalb Europas wie z.B. in Japan oder auch in den USA selbst.
Trotz dieses günstigen wirtschaftlichen Umfelds hat sich die Realisierung der europäischen Projekts als schwierig und kompliziert herausgestellt. Die EVG ist gescheitert, weil die Bereitschaft Souveränität aufzugeben, nicht so ausgeprägt war, um gerade beim sensiblen Thema Militärwesen damit zu beginnen. Auch die Entwicklung der EWG erfolgte oft sehr zäh. Als Stichpunkte dazu sollen das Veto De Gaulles gegen die Neuaufnahme von Großbritannien 1961, und seine zeitweise praktizierte Politik des leeren Stuhl bei den europäischen Institutionen (1965 bis 66) genannt werden. Oder man denke an die Mühen mit der gemeinsamen Agrarpolitik (Mitte der 70er Jahre wurden fast 90 % der EWG Mittel dafür aufgewendet, obwohl die reale Bedeutung der Landwirtschaft gemessen als Anteil der dort Tätigen oder am Anteil des BIP ständig im Sinken war).
Aber, die EWG erwies sich als Erfolgsmodell. Sie hat neue Mitglieder aufgenommen, die Integration vertieft und neue Politikfelder in die gemeinschaftliche Zuständigkeit überführt. Alternativorganisationen, wie etwa die EFTA, konnten sich nicht wirklich behaupten. Die Besonderheit der EWG/EG bestand im Gegensatz etwa zur EFTA von Anfang an darin, dass sie eigene supranationale Institutionen aufbaute und diese im Laufe der Zeit stärkte. Damit verbunden war jeweils eine Souveränitätsübertragung von den Mitgliedsstaaten auf die Gemeinschaft. Dies ist bemerkenswert, weil über die langfristige Zielsetzung des Einigungsprozess (die sogenannte Finalitätsfrage, z.B. Bundesstaat oder Staatenbund) nie eine verbindliche Übereinkunft getroffen wurde, ja nicht einmal ein informeller Grundkonsens aller Beteiligten hergestellt werden konnte.
Das europäische Projekt wurde unter Anleitung und (sanften) Druck der USA gestartet, zuerst um die europäischen Verbündeten zu stabilisieren. Durch den Nachkriegsboom dehnte sich das Wirtschaftsvolumen insgesamt aus, so dass für fast alle der Kuchen größer wurde. Deshalb führte der sich herausbildende gemeinsame Wirtschaftsraum zuerst einmal nicht zu einer starken Verschärfung der Konkurrenz. Das ursprüngliche Ziel Wiederaufbau wurde abgelöst durch neue Ziele, die deutlich über das Niveau der Vorkriegszeit hinausgingen. Im Laufe der Entwicklung konnten sich die europäischen Kapitale entfalten. Die Abhängigkeit von den USA wurde ökonomisch und politisch allmählich reduziert. Selbstverständlich gab es auch außerhalb Europas erhebliche politische und wirtschaftliche Veränderungen, die hier nicht alle dargestellt werden können. Beispielhaft soll nur der Zusammenbruch des Währungssystem von Bretton Woods genannt werden.
Die EU nach 1989
Die Auflösung des „Ostblock“ und der Sowjetunion ab November 1989 bedeutete für die EG einen erheblichen Einschnitt. Es stellten sich neue Fragen, für die eine Antwort gefunden werden musste. Ähnlich wie der beginnende Kalte Krieg das Projekt „Europäische Einigung“ stark beeinflusst hat, hat auch das Ende des Kalten Krieges erheblichen Wirkung entfaltet. Das politische Umfeld der EG/EU hat sich wesentlich geändert. Zur Debatte stand, eventuell, eine „Neuerfindung“ der EU.
In diesen Zusammenhang wurden folgende grundsätzliche Entscheidungen getroffen:
Die EG bleibt in ihrer Grundstruktur erhalten, unternimmt aber weitere Schritte in Richtung einer Vertiefung der Zusammenarbeit. Der bedeutendste Schritt ist dabei die Einführung einer gemeinsamen Währung. Nach Außen wird diese Entwicklung in der Umbenennung von EG zu EU zum Ausdruck gebracht.
In diese EU werden viele neue Mitglieder aufgenommen.
Weitgehend, wenn auch nicht vollständig, parallel dazu erfolgt die Aufnahme der gleichen Länder in die NATO.
Die „Neuerfindung“ lief also auf ein einen weiter so, aber mit vertiefter Zusammenarbeit, hinaus. Alle beitretenden Länder mussten die bestehende EU mit ihren Strukturen akzeptieren. Eine Anpassung an die vielen neuen Mitglieder fand praktisch nur in Bezug auf den Ausbau von Mehrheitsentscheidungen statt.
Die Absicht zur Vertiefung führte konkret zum Vertrag von Maastricht (1992) in dem die Ausdehnung der Gemeinschaftszuständigkeit auf Umweltpolitik, Einwanderung und Asylrecht, Gesundheit und Drogenbekämpfung festgelegt wurde und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) gestartet wurde. Mit Maastricht eng verknüpft ist das Vorantreiben der Einführung des Euro (zum 1. 1. 1999 als Buchgeld, 2002 auch als Bargeld). Diese Schritte wurden vor allem von Kohl und Mitterand vorangetrieben. Dem Vernehmen nach, war diese Vertiefung und die Einführung einer gemeinsamen Währung mehr oder weniger die Bedingung von Mitterand für die Zustimmung zur deutschen Vereinigung. Es ging also auch hier wieder, wie bereits ganz zu Beginn, um eine Einhegung von Deutschland im europäischen Verbund.
Dann war noch geplant die Europäischen Union durch eine Europäische Verfassung zu krönen. Dazu wurde ein Vorschlag vom europäischen Konvent erarbeitet, dieser wurde 2004 von allen Mitgliedern unterzeichnet und sollte 2006 in Kraft treten. Aber in Frankreich und den Niederlanden wurde die Ratifizierung 2005 durch Volksabstimmungen abgelehnt. Als Ausweg aus dieser Sackgasse wurde stattdessen 2007 der Vertrag von Lissabon abgeschlossen. (Formaljuristisch ändert dieser die bestehenden Verträge, aber ersetzt sie nicht wie die Verfassung das getan hätte. Durch diese formalistische Argumentation konnten weitere Volksabstimmungen umgangen werden. Inhaltlich bleiben die Vorschläge der Verfassung aber weitgehend erhalten.) Dieser Vertrag ist das heute maßgebende Dokument für die EU.
Die EU heute, Charakteristika und Probleme
Durch die Erweiterungen hat sich die Heterogenität in der EU stark vergrößert. Das betrifft sowohl die materielle Basis, also die ökonomische Situation der einzelnen Mitglieder, als auch die politischen Verhältnisse und Traditionen. Die Interessen sind vielseitiger geworden, auch die Art wie sie sich organisieren und in der politischen Sphäre zum Ausdruck gebracht werden.
Es gibt heute mindesten drei „Gruppen“, der „Nordwesten“ (hier konzentrieren sich die EU-weit und international konkurrenzfähigen Kapitale, man legt Wert auf geringe Staatsdefizite), der „Süden“ (schwächere Wirtschaftskraft, weniger konkurrenzfähig, Neigung zu größeren Staatsdefiziten) und der „Osten“ mit ganz eigenen Interessen und Politikstilen. Eine Besonderheit der osteuropäischen Länder liegt darin, dass sie nach Ende des Realsozialismus keine etablierte Kapitalistenklasse aufweisen konnten. In der Folge wurden sehr viele Bereiche (Industrie, Banken, Handel) von ausländischen Kapital übernommen. Damit ist eine große Zone mit abhängigen Kapitalismus in der EU entstanden. Zusätzlich gibt es innerhalb dieser Länder starke Unterschiede im ökonomischen Entwicklungsstand, etwa zwischen Tschechien einerseits und Rumänien/Bulgarien andererseits.(Auf eine ausführlichere Untersuchung der östlichen Mitglieder und ihrer Bedeutung für die EU muss hier verzichtet werden, genauso wie auf die Darstellung des Verhältnis der EU zur Ukraine und zu Russland.)
Scheitern der gemeinsamen Asylpolitik
Die Blockade der EU in der Migrations- und Flüchtlingspolitik ist ein Beispiel für die spezielle Positionierung der osteuropäischen Länder. Durch ihre strikte Weigerung Migranten aufzunehmen, wird die angeblich gemeinschaftliche Asylpolitik untergraben. Der Anspruch der EU als Problemlöser aufzutreten, wird als Unfähigkeit bloßgestellt
Die Folgen der Euro Einführung
Die Einführung des Euro verlief technisch reibungslos und die neue Währung konnte sich einen respektablen Platz unter den kapitalistischen Währungen erobern und behaupten. Der Euro hat das Währungsrisiko unter den beteiligten Ländern ausgeschaltet und gewiss auch die Schwankungen zu den anderen Währungen, insbesondere den Dollar, wegen seines viel größeren Gewichts limitiert. Aus dieser Sicht kann man den Euro durchaus als Erfolg werten. Allerdings gibt es auch eine Problemseite. Die Einführung des Euro war als eine Vertiefung der Integration gedacht (oder wurde zumindest so angekündigt). Aber die Einheitswährung löste keine (quasi automatische) Angleichung der Verhältnisse über den Markt aus. In der Realität wurde durch die gemeinsame Währung die unterschiedliche ökonomische Stärke der Länder weiter verstärkt anstatt abgebaut. Ein deutliches Zeichen dafür sind die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, großen Exportüberschüssen, besonders von Deutschland, stehen logischerweise Leistungsbilanzdefizite bei anderen Ländern gegenüber. Eine gemeinsame Währung für einen disparaten Wirtschaftsraum ist aber ein Problem. Sie lässt nur eine gemeinsame Geld- und Zinspolitik zu, obwohl für einzelne Mitglieder der Währungsunion eine Differenzierung sinnvoll und notwendig wäre. Von dem vollzogenen Schritt, der Einführung des Euro, geht deshalb ein gewisser Druck aus, weitere Vereinheitlichungen des betroffenen Wirtschaftsraum folgen zu lassen. Finanztechnisch ist das durch die sogenannte „Europäische Bankenunion“ von 2014, die die EZB als zentrale Bankenaufsicht einsetzt und einen einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus festlegt, teilweise schon geschehen. Erforderlich wäre aber neben der rechtlich, formalen Seite auch eine größere materielle Gleichheit, das heißt entweder eine reale Angleichung der Ökonomien der Euro-Länder und/oder ein finanzieller Transfer von den starken in die schwachen Länder, gewissermaßen analog zum Finanzausgleich zwischen den deutschen Bundesländern. Es gibt Anzeichen dafür, dass auch einflussreiche Regierungen in der EU diese Problematik erkannt haben und zu einem gewissen Gegensteuern bereit sind (z.B. kann man die Vorschläge von Macron so sehen, eine genauere Analyse dieser Vorschläge kann hier leider nicht erfolgen). Allerdings ist unklar, was davon umgesetzt wird und es gibt starke Widerstände gegen eine solche Politik. Die Alternative zu einer Angleichung ist ein bewusstes Hinnehmen der Unterschiede zwischen armen und reichen Regionen und deren weiteres Anwachsen. Auf Dauer wäre das ökonomischer und politischer Sprengstoff und Basis für neue Krisen. Klar ist, dass sich der Euro nur technisch, durch sein Vorhandensein und der Schwierigkeit und der Risiken einer Rückabwicklung als Klammer für die Zusammenhalt der EU erwiesen hat. Ökonomisch und sozial ist er bis jetzt ein Spaltpilz.
Die Stellung Deutschlands: Führungsmacht, Hegemon oder?
Es wurde schon mehrmals darauf hingewiesen, dass die Einhegung Deutschlands ein wesentliches Motiv bei der Schaffung der gemeinschaftlichen Strukturen war. Sogar bei der Einführung des Euro soll dies noch eine Rolle gespielt haben. Letztlich ist aber Deutschland die stärkste Kraft in der EU geworden. Gegen einen deutschen Widerspruch geht praktisch nichts. Allerdings ist die Vormachtstellung nicht so stark, dass Deutschland die EU allein dominieren könnte. Es braucht dazu Verbündete. Diese Aussage bezieht sich nicht nur auf die formale Seite, also auf Abstimmungen im EU-Rat, bei denen jeweils eine Mehrheit organisiert werden muss. Deutschland kann nur dann als Führungsmacht auftreten, wenn es auch die allgemeinen Interessen aufgreift und vertritt. Hegemonie bedeutet, normalerweise, nicht extrem einseitiges Agieren, sondern das Finden einer Balance. Im Allgemeinen war sich die deutsche Politik dessen bewusst und pflegte einen vorsichtigen Politikstil. In jüngerer Zeit gibt es aber Anzeichen, dass versucht wird die eigenen Interessen härter durchzusetzen. Insbesondere wenn es, aus deutscher Sicht, um Kerninteressen geht, wie etwa bei der Verteidigung der starken Exportposition (innerhalb und außerhalb der EU), die Durchsetzung von ausgeglichenen Staatshaushalten bzw. strikte Austeritätspolitik bei Krisen und die Ablehnung von weiteren Transfers innerhalb der EU.
Demokratiedefizit
Die Kompetenzen des EU Parlament wurden mehrmals erweitert. Aber sie haben immer noch nicht das erreicht, was bei Parlamenten in demokratischen Staaten üblich ist.
Das beginnt das mit dem Wahl-modus, zur Zeit zählt nicht jede Stimme gleich. Die kleinen Länder sind überproportional vertreten. Die Zahl der Sitze ist letztlich ausgehandelt. Es gibt keine Formel die die Zahl der Sitze z.B. nach Bevölkerungsgröße errechnet.
Und dem Parlament fehlen wichtige Rechte, insbesondere das Budgetrecht und das Recht die Exekutive, also die EU-Kommission, wirklich zu bestimmen.
Durch die Art der Entscheidungsfindung in der EU wird die politische Substanz der zu entscheidenden Fragen eher verschleiert als offengelegt. Generell ist der Rat, das heißt die Staats- und Regierungschefs oder die Fachminister, das bestimmenden Gremium. Die eigentliche Arbeit bei der Vorbereitung von Verordnungen (= Gesetzen) findet in etwa 150 Arbeitsgruppen statt. In diesen Arbeitsgruppen beraten Beamte aus den Fachministerien der Mitgliedsländer über die Vorschläge der Europäischen Kommission, die allein das formale Recht der Gesetzesinitiative hat.
Zuerst muss sich jede Regierung der Mitgliedstaaten intern auf eine Position einigen, was je nach Konstellation und gegebener Koalition schon sehr schwierig sein kann. Dann wird diese Position mit den anderen Regierungen verhandelt, mit entsprechenden Zugeständnissen und Gegengeschäften, die natürlich auch Thema übergreifend sein können. Die Arbeitsgruppen und auch der Rat der Minister bzw. Regierungschefs, die dann letztlich die Beschlüsse fassen, tagen grundsätzlich geheim. Es gibt keine öffentlich einsehbaren Protokolle oder ähnliches. Offiziell veröffentlicht werden nur die Beschlüsse, nicht aber die Argumentation, die Taktik der Verhandlung, begleitende Absprachen etc. Dieses etwas undurchsichtige Verfahren bietet den zahlreich vorhandenen Lobbygruppen günstige Möglichkeiten auf den Gang der Dinge einzuwirken. Der, oft mühsam, im Rat gefundene Kompromiss muss zwar, in vielen aber nicht allen Fällen, noch vom EU Parlament behandelt und gebilligt werden. Meistens ist das Parlament aber nicht in der Lage das im Rat verhandelte Paket noch einmal aufzuschnüren. In der Öffentlichkeit werden Entscheidung oft nach dem Muster wahrgenommen: Deutschland (oder Frankreich oder die Südländer etc.) hat/haben sich durchgesetzt oder nachgegeben. Die Entscheidungsfindung wird also (mit einen gewissen Recht) als Konkurrenz zwischen Staaten und nicht als Konkurrenz von politischen Richtungen wahrgenommen.
Die Art wie in der EU Entscheidungen getroffen werden ist für viele nicht mehr durchschaubar. Dementsprechend entsteht der Eindruck von übermächtiger Bürokratie und von Einmischung von Anderen/Fremden in die eigenen Angelegenheiten und von einer diffusen Abhängigkeit von „Brüssel“. Richtig ist auch, dass Politiker verschiedener Couleur (oft die deklarierten EU-Freunde) sich aus durchsichtigen opportunistischen Gründen hinter der EU verstecken. Regelungen, an denen ihre Partei und ihre Regierung aktiv mitgewirkt hat, werden als Vorgabe von „Brüssel“ dargestellt. Es wird verschwiegen, wer diese Regelung betrieben hat und warum er dies gemacht hat.
Festschreibung Neoliberaler Hegemonie
Seit dem Vertrag von Maastricht und spätestens seit dem Lissabonner Vertrag, der ja sozusagen die Verfassung der EU darstellt, ist ein klares neoliberales Wirtschaftsmodell die Handlungsgrundlage der EU.
Die Basis bilden die vier, bereits in den Römischen Verträgen als Ziele deklarierten vier Grundfreiheiten. Das sind die
• Kapitalverkehrsfreiheit
• Warenverkehrsfreiheit
• Dienstleistungsfreiheit
• Personenverkehrsfreiheit.
Relevant ist dabei besonders, wie diese Freiheiten inzwischen vom Europäischen Gerichtshof interpretiert werden, nämlich nicht mehr als Ziele, sondern als Grundrechte, die von einzelnen einklagbar sind.
Weitere neoliberale Festschreibungen im EU Recht sind
• das Beihilfeverbot (sprich das Verbot von Subventionen, der Rat kann aber Ausnahmen genehmigen)
• Strikte Vorgaben für öffentliche Ausschreibungen
• die Vorgabe, dass bei der Eisenbahn, der Post, den Telekommunikations- und Energienetzen Wettbewerb vorhanden sein muss (und damit ein einziger öffentlicher Anbieter ausgeschlossen ist).
Zentral ist der Vertrag von Maastricht (1992) und der sogenannten Stabilitätspakt (1997), die die Grundlage für die Einführung der Euro bilden. Hier sind die Verschuldungsgrenzen 3% und 60% definiert. Die Unabhängigkeit der EZB (von den Regierungen aber auch von jeder demokratischen Kontrolle) und die Verpflichtung der EZB allein auf das Ziel der Preisstabilität, und nicht auch auf Vollbeschäftigung, das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank.
Wesentlich bei den oben genannten Festlegungen ist ihre Verankerung im EU Primärrecht. Das heißt sie sind Bestandteil des Lissabonner Vertrags. Und dieser kann nur einstimmig geändert werden und die Änderung muss dann von allen Mitgliedsländern ratifiziert werden. Somit würde bereits ein Land genügen, um eine Änderung zu blockieren.
Eine Weiterentwicklung stellt der sogenannte Fiskalpakt von 2012 dar. Dieser Pakt ist nicht im europäischen Primärrecht verankert, sondern als zusätzlicher Völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Regierungen abgeschlossen (ohne GB, Tschechien und Kroatien). Die Überführung in das EU Vertragsrecht war/ist für später geplant, die im Pakt genannte Frist von fünf Jahren ist aber bereits überschritten.
Der Fiskalpakt bezieht sich auf die Bestimmungen des Stabilitätspakt und des Maastrichter Vertrags, konkretisiert und verschärft sie.
Im einzelnen verpflichten sich die Länder:
• Auf einen ausgeglichenen Haushalt (dabei gilt ein Defizit von 0,5% des BIP als ausgeglichen) und einen Abbau der Staatsverschuldung auf unter 60% des BIP.
• Auf die Aufnahme von Regeln, die im Prinzip der deutschen Schuldenbremse entsprechen, in ihre Verfassung oder eine Kodifizierung auf vergleichbaren Niveau.
Allerdings sieht der Fiskalpakt mehrere Ausnahmemöglichkeiten vor, die durch Sondersituationen oder konkreten Bedingungen eines Landes bedingt sein können.
Die EU Kommission hat die Aufgabe den Fiskalpakt zu überwachen. Die Länder müssen regelmäßig über ihre Bemühungen die Regeln einzuhalten berichten. Die jüngsten Diskussionen zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über den italienischen Haushalt beruhen auf diesen Fiskalpakt.
Seinen bisher deutlichsten Ausdruck hat die Neoliberalisierung bisher in der Behandlung der Krisen um Griechenland gefunden.
Europa als Friedensgarant?
Richtig ist, dass es nach 1945 in Europa weitgehend friedlich geblieben ist. Ein Krieg etwa zwischen Frankreich und Deutschland ist heute geradezu unvorstellbar geworden. Richtig ist aber auch, dass das nur innerhalb der EU und im Bezug zu anderen europäischen „Kernländern“ gilt. Die Auflösungskriege um Jugoslawien haben gezeigt, auch in Europa sind Kriege noch möglich und die EU bzw. ihre führenden Mitglieder waren dabei keineswegs nur Friedensstifter. Bei nüchterner Betrachtung muss man auch zum Ergebnis kommen, dass der entscheidende Faktor für die friedliche Entwicklung zwischen den europäischen Ländern nicht in erster Linie die EU ist, sondern der Zusammenhalt der kapitalistischen Länder gegen die Sowjetunion unter der Hegemonie der USA. Verändert sich diese Konstellation, gerät auch der Friede in Europa in Gefahr. Auch das haben die Kriege in Jugoslawien gezeigt.
Vergessen darf man auch nicht, dass EWG/EU Mitglieder von Anfang an an diversen Kriegen beteiligt waren, etwa Frankreich in Indochina, Algerien, bei der Suez-Krise und bei vielen weiteren Einsätze in Afrika, Großbritannien bei der Suez Krise, im Falkland- und Irakkreig, auch Deutschland ist mit etlichen Auslandseinsätzen vertreten.
Die Vorstellung von der „Friedensmacht EU“ wird durch einige Äußerlichkeiten (scheinbar) unterstützt, z.B. durch die Arbeitsteilung zwischen EU und NATO. Für militärisches ist eben die NATO zuständig und nicht die EU. Die Schwierigkeit der 28 Mitglieder gelegentlich eine gemeinsame Linie zu finden, führt dann dazu, dass sich die EU als ganzes nur zurückhaltend positionieren kann. Man kann das als vorsichtige Politik missverstehen. Viele Kommentatoren bejammern es wortreich als Schwäche und mangelnde Handlungsfähigkeit Europas. Real bedeutet das aber nur, die EU kann (noch?) nicht effizient genug als imperialistischer Akteur auftreten.
Militarisierung
Neuere Entwicklungen strafen das Gerede vom Friedensprojekt EU sowieso Lügen, besonders das Projekt PESCO (Permanent Structured Cooperation). Hier geht es um die Zusammenarbeit auf militärischen Gebiet. 2017 wurde diese Kooperation gestartet 25 Länder beteiligen sich daran (ohne GB (Brexit), Dänemark und Malta).
Die teilnehmenden Staaten verpflichten sich ihre „Verteidigungsausgaben stetig weiterzuentwickeln“ (es wird aber nicht festgelegt was das genau bedeutet z.B. im Sinne von Prozentsätzen oder Zeiträumen) und zur Teilnahme an europäischen Ausrüstungsprogrammen, wobei die Teilnahme an den einzelnen Rüstungsprojekten separat entschieden wird. PESCO bringt zwar eine gewisse Ausformung des Gemeinschaftsrechts bei militärischen Fragen, die Souveränität der Länder ist aber ausdrücklich nicht aufgehoben.
Es gibt starke Kräfte in der EU, die PESCO nur als Anfang betrachten und darauf hinwirken, die militärische Zusammenarbeit weiter auszubauen.
Ausblick
30 Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion sind weitere einschneidende Veränderungen der weltpolitischen Situation erkennbar. Das soll hier nur stichpunktartig festgehalten werden.
Der Aufstieg Chinas – insgesamt eine Verschiebung des ökonomischen Schwerpunkts nach Asien, darin eingeschlossen ist ein relativer Bedeutungsverlust Europas.
Das Verhältnis USA - Europa steht ernsthaft zur Debatte. (Und das vermutlich auch ohne den speziellen Politikstil von Trump.) Bisher war es immer noch ein Verhältnis von Hegemon zu abhängigen Verbündeten.
Auch bezüglich der näheren und weiteren Umgebung von Europa (Russland, Türkei, Naher Osten, Afrika) gibt es mehr Fragezeichen als Gewissheiten.
Die Einschätzung der EU fällt in dieser Hinsicht zwiespältig aus. Einerseits ist die EU als großer Verbund wesentlich besser gerüstet mit anderen Mächten harte Verhandlungen und Kämpfe auszufechten als es die vielen europäischen Nationalstaaten einzeln wären. Andererseits stellt sich die Frage, ob die Vereinheitlichung der EU wirklich schon so weit fortgeschritten ist, um in allen diesen, zum Teil sehr fundamentalen Fragen eine gemeinsame Position vertreten zu können. Eventuell sind die materiellen Unterschiede einfach zu groß, so dass einzelne Länder bessere Wege ohne EU für sich erkennen, oder glauben erkennen zu können.
Es ist offensichtlich, dass eine gemeinsame Linie schon jetzt sehr schwierig zu erreichen ist. Die weitere Abgabe von Souveränität in zentralen Themen wie Außenpolitik und Militärwesen an eine Zentralinstanz, wäre für viele Staaten und ihren herrschenden Klassen mit Risiken und Einflussverlust verbunden. Es ist aber denkbar, dass ein Schub für mehr Zentralität dann erfolgt, wenn die Umstände (Konkurrenz zu USA und/oder China) eine stärkeren Zusammenschluss der europäischen Kräfte nahelegen oder erzwingen.
Nicht unwahrscheinlich ist ein weiteres Auffächern in eine EU der verschiedenen Geschwindigkeiten und der verschiedenen Integrationsstufen, die es in der Praxis schon seit einiger Zeit gibt.
Trotz jahrzehntelangen Aufbau eines gemeinsamen Marktes und gemeinsamer Institutionen ist die Entwicklung noch nicht unumkehrbar. Der Ausgang ist offen. Alle denkbaren Pfade (von weiterer Integration hin zu einem Bundesstaat bis zu einem Auseinanderbrechen) sind möglich. Potentielle, auch die Substanz erschütternde Krisen, sind am (durchaus nahen) Horizont erkennbar, wie etwa eine große kapitalistische Überproduktion/Schuldenkrise oder die Klimaänderung mit ihren direkten und indirekten Folgen. Aber hier und heute lässt sich der reale Verlauf mit seinen politischen Implikationen nicht prognostizieren.
Juni 2019
(Hinweis: der folgende Text ist wegen einer technischen Panne nicht in der gedruckten Ausgabe der ARSTI Nr. 204 enthalten, sondern erst in Nr. 205)
Die EU – Beiträge zu einer linken Strategie
Bei den linken Parteien und Bewegungen in Europa kann man 3 grundsätzlich verschiedene Positionen zur EU finden:
Orientierung auf Reform der EU
Plan A und B
Lexit (Lef Exitt=Linker Austritt)
Die häufigste Position ist die Forderung nach einer Reform der EU. Der Änderungsbedarf wird vor allem bei der Neoliberalisierung, Militarisierung und dem Demokratiedefizit gesehen. Die geforderten Änderungen sind grundlegend. Ihre Realisierung würde eine wesentliche Umgestaltung der EU bedeuten. Sie sind nicht mit den Reformvorschlägen zu verwechseln, wie sie von Politikern wie Macron gemacht werden, die nicht auf eine Umgestaltung, sondern auf eine verbesserte Funktionalität der bestehenden EU abzielen. Die Forderung nach einem Umbau der EU, „für ein anderes Europa“ wird von vielen Mitgliedern der „Europäischen Linken“ z. B. auch von der Partei „Die Linke“ vertreten. Unter Berücksichtigung des vorhandenen Kräfteverhältnis dürfte es in absehbarer Zeit eher um die Sichtbarmachung der eigenen Positionen gehen, als um die reale Durchsetzung dieser Forderungen.
Den Kontrapunkt zur Reformstrategie setzen die Anhänger eines Lexit (Left Exit, Linker Austritt). Sie teilen mit den Reformern weitgehend die inhaltliche Kritik an der EU. Insofern besteht Konsens. Aber sie halten die Strukturen der EU und/oder des Euro für von Grund auf neoliberal und für nicht reformierbar. Sie rufen dazu auf, die Illusion der Reformierbarkeit der EU aufzugeben und sich prinzipiell für einen Austritt aus der EU mit einer linken Begründung einzusetzen. Nur so könne wieder Spielraum für eine linke Politik gewonnen werden. Auch diese Position hat eine relevante Anhängerschaft, oft als Minderheit in reformorientierten Parteien. Von den größeren Organisationen vertritt in Deutschland die DKP diesen Standpunkt , sonst etwa auch die KKE und die portugiesischen Kommunisten (PCP).
Eine Zwischenposition stellt in gewisser Hinsicht die Strategie von La France Insoumise dar, die sie „Plan A und Plan B“ nennen.Eine Regierung von La France Insoumise würde zuerst in Verhandlungen mit den anderen EU Mitgliedern treten, um eine Änderung der EU Politik (im Sinne von weg vom Neoliberalismus) zu erreichen. Das wäre Plan A.Sollte Plan A scheitern, wären auf nationaler Basis einseitig Schritte in der Sozial- und Wirtschaftspolitik einzuleiten, die die neoliberalen EU-Regeln bewusst missachten und bis zum Austritt aus dem Euro und eventuell auch aus der EU führen könnten (Plan B). Nach ihrer Einschätzung würde der Austritt eines großen und zentralen Landes wie Frankreich (besser wäre natürlich ein koordiniertes Vorgehen von mehreren Ländern) ein erhebliches Drohpotential darstellen, das die anderen Länder zum Einlenken bei Plan A bewegen könnte. Das setzt voraus, dass man gegebenenfalls bereit und darauf vorbereitet ist Plan B durchzuziehen. Eine erkennbar leere Drohung wäre natürlich wirkungslos.Diese Strategie wurde aufgrund der Erfahrungen mit den Auseinandersetzungen EU-Griechenland erarbeitet. La France Insoumise wirft Syriza vor, nicht genügend vorbereitet gewesen zu sein bzw. im entscheidenden Augenblick Verrat geübt zu haben und hat deswegen auch den Ausschluss von Syriza aus der „Europäischen Linken“ verlangt. Inzwischen haben sich Podemos in Spanien und der Bloco de Esquerda in Portugal dieser Strategie angeschlossen. Diese 3 Organisationen bilden auch den Kern der neuen politische Allianz „Maintenant le Peuple“ bzw. „Now the People“,“Jetzt das Volk“.
Die Basis für eine Strategie ist die Einschätzung des Stellenwerts der EU für die vergangene und zukünftige Entwicklung, ökonomisch und gesellschaftlich. Dabei stellt sich die Frage:
Ist die EU die Folge einer notwendige Entwicklung im Kapitalismus ?
Ohne Zweifel kommt die EU den Bedürfnissen des Kapitals, und insbesondere international konkurrenzfähigen Kapitalien wie sie z.B. in Deutschland gehäuft vorhanden sind, entgegen. Das Kapital und seine Vertretungen haben dementsprechend immer für die Zusammenarbeit in der EU, ihre Erweiterung und Vertiefung plädiert. Seine Interesse sind ja auch gut bedient worden. Ist die EU aber die Folge einer notwendigen Entwicklung ?
Der Kapitalismus hat allgemein die Tendenz sich auszudehnen und dabei Beschränkungen, die sich einer Ausdehnung entgegenstellen zu überwinden. Eine Art von Beschränkung stellen dabei Staatsgrenzen dar. Staatsgrenzen sind aber für das Kapital widersprüchliche Beschränkungen. Denn das Eingrenzende und damit Hemmende ist nur die eine Seite, die andere Seite liegt darin dass Staaten (mit-)verantwortlich sind, geeignete Bedingung für die kapitalistische Entwicklung im Inneren zu schaffen. Dies geschieht durch die Bereitstellung von Infrastruktur und durch die Errichtung einer Rechtsordnung und ihre Durchsetzung mit dem Gewaltmonopol des Staates. Des weiteren kann ein Staat auch die Interessenvertretung nach Außen gegenüber anderen Staaten übernehmen. Die Kapitalisten sind und waren immer (das lässt sich historisch zeigen) auf einen in ihrem Sinne gut funktionierenden Staatswesen angewiesen. Diese, sehr verkürzt dargestellten, Verhältnisse fanden in der Epoche der Nationalstaaten ihren typischen historischen Ausdruck.
Aber Staatsgrenzen sind eben auch einengende Grenzen für das Kapital. Der Kolonialismus war z.B. ein historischer Weg solche Grenzen zu überwinden. Es wäre falsch, die Epoche der Nationalstaaten jetzt einfach für überwunden zu erklären und die entsprechenden Triebkräfte für nicht mehr existent. Aber offensichtlich ist, dass die feindliche bis kriegerische Konkurrenz von Nationalstaaten, auch im Kapitalismus und im ureigenen Interesse des Kapitals, nicht die einzige Möglichkeit eines Zusammenwirkens von kapitalistischen Ländern ist. Für den (West-) europäischen Raum waren dabei neben der speziellen weltpolitischen Situation nach dem 2. Weltkrieg auch folgenden Fakten wesentlich. Die traditionellen Nationalstaaten sind eher klein (oder mittelgroß), bieten also nur einen engen Heimmarkt, und in ihnen konzentrieren sich viele hochentwickelte Kapitale, die nach einem größeren Markt als ihren nationalen Heimmarkt verlangen. Der sich mit der EWG, EG und EU herausbildenden gemeinsame Wirtschaftsraum entsprach und entspricht diesem Interessen nach größeren Märkten. Die supranationale EG/EU trat ergänzend und variierend an die Seite der Nationalstaaten. Es bildete sich neben den traditionellen Marktebenen lokal, regional, national, global, die neue Ebene EU-europäisch heraus, zwischen national und global. Der Unterschied zwischen national und global besteht in der staatlichen Einbettung des nationalen Marktes (Rechtssystem, Gewaltmonopol des Staates, Zusammenfassung des politischen Willens), während der globale Markt keine solche Vereinheitlichung aufweist. Mit dem gemeinsamen europäischen Markt hat sich nach und nach auf supranationaler Ebene ein staatsähnliches Gebilde mit eigenen Institutionen und einer immer weiter fortschreitenden einheitlichen Verrechtlichung herausgebildet.
Es gibt Kapitale, die hauptsächlich global ausgerichtet sind, und welche die den europäischen Raum (eher) nicht überschreiten und selbstverständlich sind auch Interessenskonflikte zwischen diesen Gruppen möglich. Aber im Allgemeinen haben auch die global ausgerichteten Kapitale ein Interesse an der Ausdehnung ihres Heimmarktes hier im Sinne von national auf europäisch zu verstehen. Nebenbei bemerkt, auch auf globaler Ebene macht sich das Bedürfnis nach einheitlichen Regelungen immer stärker bemerkbar, was sich in den Freihandelsverträgen (realisiert oder nicht realisiert) wie TPP. TTIP, CETA usw. sichtbar wurde. Die Besonderheit beim europäischen Projekt liegt im Ausmaß der Vergemeinschaftung und in der auf Dauerhaftigkeit hin konzipierten Regelungen und Institutionen. Keine Fall zu Fall Regelung, sondern eine Rechtsordnung, keine ad hoc Kommissionen, sondern staatsähnliche Organe.
Die Entstehung der EU entspricht einer inneren Logik des Kapitalismus. Ist deshalb die EU notwendig ? Bis zu einem gewissen Grad ja, aber sicher nicht in exakt der Form in der sie historisch entstanden ist. Das für das Kapital dienliche Ausmaß an Vereinheitlichung hätte auch in einer anderen Art und Weise erreicht werden können. Es soll mit dieser Feststellung auch nicht gesagt werden, dass analoge Entwicklungen weltweit für alle anderen Nationalstaaten zu erwarten sind. Die Bedingungen, sowohl innerhalb der Staaten, als auch bezüglich der Beziehungen zu anderen Staaten, sind sehr unterschiedlich. Eine schematische Verallgemeinerung ist nicht sinnvoll.
Die Gründer und Propagandisten haben auf die Friedenssehnsucht und Hoffnungen, die mit der Idee eines vereinigten Europas verknüpft waren zurückgegriffen. Gleichzeitig eröffnete nach der Zeit des extremen Nationalismus, die Aussicht auf gleichberechtigte Zusammenarbeit eine freundliche Perspektive. Es ist auch unbestritten, europäische Einigung ist einem aggressiven Nationalismus vorzuziehen. Man kann das europäische Projekt als eine Variante eines kapitalistischen Internationalismus beschreiben. Klar ist, dass das etwas anderes ist als der linke Internationalismus. Aber auch ein kapitalistischer Internationalismus kommt nicht umhin, den Menschen und Verhältnissen in anderen Ländern erst einmal positiv und freundlich zu begegnen. Aggressive Hetze gegen Ausländer, Fremde etc. ist kontraproduktiv. Deshalb ist es nicht unverständlich, wenn in „fortschrittlichen Kreisen“ eine positive Beurteilung des europäischen Projekts überwiegt. Aber man darf nicht übersehen welche Grenzen diesem Projekt von Anfang an gesetzt waren (Antikommunismus) und welche Grenzen, auf Betreiben der herrschenden Klassen, heute damit verbunden sind (Neoliberalismus).
Festzuhalten ist, den verschiedenen staatlichen Ebenen, kommunal/regional, nationalstaatlich und supranational (EU) kann nicht grundsätzlich Progressivität zu- oder abgesprochen werden. Welche Rolle eine Ebene in einem konkreten Zusammenhang spielt, hängt von den Umständen ab und vom Kräfteverhältnis der dort tätigen Akteure. Neben den negativen Beispiel der Auseinandersetzung EU – Syriza/Griechenland gibt es andererseits auch die Beispiele EU – Orban/Ungarn und EU – PiS/Polen. Genauso ist die eventuelle Abspaltung von Katalonien oder Schottland für sich genommen nicht progressiv, ebenso wenig wie deren Verbleib im größeren Staatsverbund. Gemeinsam ist solchen Fragen um Nationalität und Identität oft ein erhebliches Potential von den entscheidenden (Klassen-)Fragen abzulenken und zusätzliche Spaltungen in der politischen Auseinandersetzung zu erzeugen.
Sicher ist richtig, dass es den Neoliberalen gelungen ist mit der Ausgestaltung des europäischen Primärrechts Pflöcke einzuschlagen, die ein erhebliches Hindernis für eine linke Politik darstellen. Damit wurden Festlegungen erreicht, die schwer zu verändern sind und in den meisten Fällen weit über das hinausgehen was auf nationaler Ebene verfassungsmäßig fixiert ist. Die größte Gefahr für die linke Bewegung besteht darin, dass politische Zuspitzungen nicht in vielen Ländern gleichzeitig auftreten, sondern nach und nach (mit größeren zeitlichen Abständen) in einzelnen Ländern. Dadurch könnten die Kämpfe auf einzelne Brennpunkte und Länder beschränkt und damit isoliert bleiben, während die Länder bzw. die dort kämpfenden Akteure sich nicht gegen die Übermacht der anderen EU-Mitglieder behaupten können. Sei es wegen der Einbindung in das EU-Recht, oder wegen bestehenden faktischen Abhängigkeiten.
Die spekulative Frage, was wäre ohne EU ?
Wenn ernsthaft über einen Austritt aus der EU diskutiert wird, stellt sich die Frage was wäre ohne EU ? Das ist eine weitgehend spekulative Frage. Es ist unmöglich konkrete Aussagen darüber zu machen, was etwa in Situationen wie der Griechenlandkrise geschehen wäre, wenn es keine (oder eine ganz andere) EU gegeben hätte.
Aber man kann feststellen: Durch einen Austritt ändert sich zuerst einmal nichts an realen in Jahrzehnten entstandenen Verflechtungen und sich daraus ergebenden Abhängigkeiten, materieller und finanzieller Art. Es ändert sich nichts an den Stärken und Schwächen der beteiligten Ökonomien. Durch einen Austritt kann sich ein Land der Vorgaben im EU Primärrecht entledigen. Ohne Zweifel hätte dies seine Bedeutung. Aber der Neoliberalismus hätte sich deswegen nicht aufgelöst, seine Hegemonie wäre nicht automatisch gebrochen. Die Verankerung des Neoliberalismus im Primärrecht war möglich, weil der Neoliberalismus in den letzten Jahrzehnten eine eindeutig hegemoniale Position innehatte, in der EU und in den (meisten) Nationalstaaten. Das Primärrecht ist eine Folge dieser Hegemonie, aber nicht unbedingt seine stärkste Bastion. Die Macht des Kapitals gründet sich nur teilweise auf Rechtspositionen. Durch einen Austritt allein würden sich die Machtverhältnisse noch nicht wirklich ändern.
Eine breite politische Abstützung durch eine starke Bewegung verschafft ihren Protagonisten Spielraum, auch gegenüber der EU. Paragraphen und Verträge können interpretiert werden, manchmal auch innovativ und kreativ. Allerdings zeigt das Beispiel Griechenlands wie begrenzt die Macht einer Regierung, trotz Unterstützung der Bevölkerung (Referendum), in der Realität sein kann. Aber die Macht und die Stärke der Position Schäubles (und seiner Unterstützer) lag nicht in den rechtlichen Gegebenheiten, sondern in der Möglichkeit Griechenland von der Geldversorgung abzuschneiden und in den Staatsbankrott zu treiben. Weiterhin war entscheidend, dass es Tsipras nicht gelungen war in anderen Ländern und/oder bei anderen regierenden Parteien nennenswerte Unterstützung zu finden. Solche realen Machtkonstellationen sind nicht unbedingt an eine Mitgliedschaft gebunden. Es gab schon etliche verschuldete Länder, die vom Kapital, vertreten durch den IWF, zu einem harten Sparprogramm gezwungen wurden.
Noch eine Bemerkung. Beim Lesen von Beiträgen linker EU Kritiker, entsteht der Eindruck, die Autoren würden allesamt die Möglichkeiten durch staatliche Interventionen Ziele wie Vollbeschäftigung, Abbau von Armut und Ungleichheiten usw. zu erreichen, als groß einschätzen. Dies wird zwar nicht direkt behauptet, aber auch nie problematisiert, vermutlich weil es außerhalb des behandelten Themas (EU) liegt. Aber es gilt daran zu erinnern: die Frage nach Chancen und Grenzen von Staatseingriffen und welche sozialen Ziele im Kapitalismus überhaupt erreichbar sind, ist keineswegs trivial. Traditionell gibt es unter den Linken dazu keine einheitliche Position. Und es gibt viel Raum für Illusionen.
Welche Folgerungen ziehen wir aus dieser Analyse ?
Folgende Eckpunkte sollten bei der Formulierung einer konkrete Politik zum Umgang mit der EU als Basis dienen. (Es gibt dabei eine gewisse Ähnlichkeit mit Positionen, die ATTAC in Österreich erarbeitet hat.)
Die EU ist kein Wert an sich, sie ist kein Friedensprojekt, sie ist kein übergeordnetes Ziel das grundsätzlich anzustreben und/oder zu verteidigen ist.
Andererseits ist auch ein Austritt kein Ziel an sich. Abgelehnt wird bei der EU nicht das Supranationale, sondern die neoliberalen Grundsätze, die Militarisierung, das Demokratiedefizit, Sozialabbau etc., genauso wie solches auch in den Nationalstaaten abgelehnt wird.
Wenn sich Chancen ergeben, in der EU Veränderungen im linken Sinne zu erreichen, sind solche Bestrebungen selbstverständlich zu unterstützen. Ein weiterer Ausbau der EU wird nicht grundsätzlich bekämpft. Auch eine eventuelle Entwicklung hin zu einem Bundesstaat könnte prinzipiell akzeptabel sein, es sei denn, sie ist direkt mit Vorhaben wie etwa einer weiteren Militarisierung verbunden.
Aber es sind Situationen denkbar, in der die Forderung nach einem Austritt sinnvoll und notwendig sein kann. Eine Beurteilung von solchen Alternativen kann nicht generell erfolgen, sondern immer nur in Hinblick auf eine konkrete Situation, konkreten Umstände und Kräfteverhältnisse.
Was Deutschland betrifft, sind keine Kämpfe in Sicht, die eine Frage nach einen Austritt aufwerfen würden. Die Schwäche der Linken erlaubt für uns keinen großen Entwurf a la Plan A und Plan B (ob das für Frankreich wirklich anders ist, sei dahingestellt).
Die bereits jetzt vorhandenen Verflechtungen zwischen den Ländern, bestehende Lieferketten und sonstigen Abhängigkeiten sind sehr groß. Eine eventuelle Austrittsstrategie muss ein klares und realistisches Bild von den Risiken, die damit verknüpft wären, besitzen. Eine Fehleinschätzung könnte verheerend sein.
EU Kritik bis zu Austrittsforderungen kommt auch von den Rechten. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich Linke weder direkt noch indirekt in rechte Strategien einbinden lassen.
Selbstverständlich setzen wir dem Internationalismus des Kapitals unseren solidarischen Internationalismus entgegen. Die internationale Zusammenarbeit von linken Organisationen (Parteien, Gewerkschaften etc.) in Europa und darüber hinaus ist auszubauen und zu vertiefen, soweit das in unseren Möglichkeiten liegt.
Juni 2019