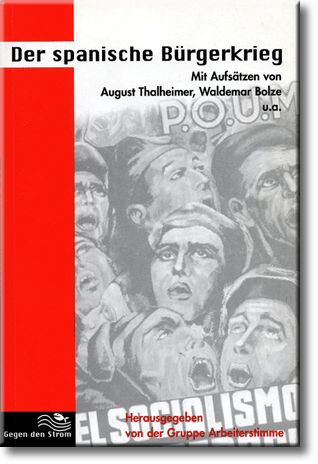Krisenbewältigung als Gefahr für die Demokratie
Da hat man jahrzehntelang vor den Notstandsgesetzen als großer Gefahr für die Demokratie gewarnt, und reibt sich jetzt verwundert die Augen, welcher Demokratieabbau mit dem Infektionsschutzgesetz möglich ist. Während die Ausrufung des „Verteidigungsfalls“, immerhin, noch eine Zweidrittelmehrheit des Parlamentes erfordert, reicht beim Infektionsschutzgesetz eine schlichte Rechtsverordnung – und aus ist es mit der Versammlungsfreiheit, der Freizügigkeit und weiteren Grund- und Bürgerrechten.
Die Maßnahmen, denen die Gesellschaft seit Wochen unterworfen wird, mögen zur Vermeidung eines Massensterbens angemessen sein – die politische Begleitmusik ist es nicht. Denn diese degradiert die Bevölkerung vom Souverän zum bloßen Objekt der Politik und behandelt sie wie ein störrisches Kind. Das Bundeskanzleramt sprach an einem März-Wochenende tatsächlich davon, die Bevölkerung werde einer „Reifeprüfung“ unterzogen, ob sie sich des Ernstes der Lage bewusst sei. Üblich, oder sagen wir: in der Demokratietheorie, ist es so, dass das Volk die Regierungen auf deren Reife bzw. Tauglichkeit prüft, und nicht umgekehrt. Aber jetzt heißt es nur von oben: Geht Euch die Hände waschen und dann ab ins Bett!
Während ansonsten jedes neue Antiterror-, sprich Überwachungsgesetz den Protest zumindest von Teilen der Gesellschaft hervorruft, im Parlament beraten, einer Expertenanhörung unterzogen, von wenigstens formalen Abwägungen zwischen Sicherheitserfordernissen und Freiheitseinschränkungen begleitet, kurz: diskutiert wird – fehlt das alles jetzt. Nachmittags beraten Bund und Länder, und abends ist schon die Rechtsverordnung in Kraft.
Die verkündeten Bürgerrechtseinschränkungen werden nicht wirklich der in einer Demokratie unverzichtbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen. Gibt es wirklich weniger Tote, wenn man Cafés schließt, als wenn man die Leute dort im Zwei-Meter-Abstand sitzen lässt? Haben die Regierungen jeweils gründliche Abwägungen vorgenommen, als sie Versammlungen erst über 1000, dann über 500, über 100, über 50, schließlich über zwei Personen verboten haben? Hat man ermittelt, ob das Infektionsrisiko in der Schweiz größer ist als in den grenznahen deutschen Regionen, bevor man der dortigen Bevölkerung die Ausreise verboten hat?
Das sind rhetorische Fragen. Wir erleben derzeit ein Experiment, über dessen Design nur wenige entscheiden.
Hier funktioniert, was bei Bedrohungsszenarien à la Islamismus, „Linksextremismus“, Neonazis oder auch „der Russe kommt“ allenfalls partiell klappte: Das Schaffen eines (Beinahe-)Konsenses in der Bevölkerung, es sei jetzt einfach „alternativlos“, Freiheitsrechte einzuschränken, um eine drohende Gefahr abzuwenden. Auch von den Oppositionsparteien kommt, wenn überhaupt, nur sehr zurückhaltende Kritik, die sich dann meist nicht dem großen Ganzen widmet, sondern den Details der Krisenabfederung. Man lässt eben in der Stunde der Gefahr die eigene Bevölkerung nicht im Stich, und außerdem gibt es keine Parteien mehr, sondern nur noch zu schützende Risikogruppen.
Aber das stimmt natürlich nicht: Auch in der Krisenbewältigung zeigt sich Klassenpolitik. Die Kassiererin, die nach einem neunstündigen Arbeitstag nicht mit Partner und verstörtem Kind in der Zweizimmerwohnung hockt, sondern auf den Spielplatz geht, muss jetzt mit einer Geldstrafe rechnen; sich bei einem Kaffee mit KollegInnen über die Arbeitsbedingungen auszutauschen, geht nicht mehr. Das sind Sorgen, die sich Grundstücksbesitzer am Wannsee nicht machen müssen.
Und während das Spazieren zu dritt verboten wird, ist das Arbeiten zu Dutzenden immer noch vorgeschrieben. Fabriken sind offen, Callcenter auch, und zwar nicht nur diejenigen, die zum kurzfristigen Überleben notwendig sind. Um dorthin zu kommen, soll man den öffentlichen Nahverkehr meiden – eine Empfehlung, die nur von Leuten kommen kann, die sowieso mit Taxi oder privatem Fahrdienst unterwegs sind.
Streng abgewogen wird auch zwischen dem Schutz der eigenen Bevölkerung und schutzsuchenden Ausländern: Während die Bundesregierung von überall her versprengte deutsche Urlauber zurückholt – Risikogebiet hin oder her – darben auf griechischen Inseln Zehntausende Flüchtlinge. Dabei wissen alle, welche Katastrophe ein Ausbruch des Virus dort verursachen würde.
Der Modus der Krisenbewältigung droht langfristige Folgen zu haben, auch wenn sie nicht intendiert sind. Nicht nur, was die häusliche Gewalt bei zwangsbeurlaubten Familien angeht, oder die Suizidrate bei psychisch Labilen, denen die sozialen Kontakte wegbrechen, oder den Millionen, die jetzt ihre wirtschaftliche Existenz verlieren.
Sondern auch in der politischen Machtbalance. Sonntags- und Mehrarbeit sind jetzt gesetzlich erlaubt, ja sogar gesellschaftlich erwünscht. Seit Wochen, und vermutlich noch einige Monate lang, geriert sich die Exekutive als Hoffnungsanker der Bevölkerung, während die Parlamente kaum eine Rolle spielen bzw. sich selbst aus dem Spiel nehmen, weil Fraktions- und Parlamentssitzungen wegen Corona ausfallen oder derart verkürzt werden, dass sie nur noch das Abnicken von Regierungsmaßnahmen ermöglichen. Die Öffentlichkeit ist eh im Hausarrest, die Regierung meint es ja nur gut mit uns. Grenzen schließen mitten in Europa – auf einmal kein Problem. Die CDU bekommt schon wieder feuchte Träume vom Bundeswehreinsatz im Inland, z. B. um Ausgangssperren zu überwachen oder Flüchtlinge im (Quarantäne-)Lager zu halten.
Klar, alles nur vorübergehend – aber in dieser Zeit wird nicht nur diskursiv etwas bewirkt, sondern auch materiell. Ein Jahr ohne Streikrecht, ohne Versammlungsfreiheit – das geht nicht spurlos an der Gesellschaft vorbei. Der DGB berichtet bereits über Versuche von Unternehmern, ArbeiterInnen und Angestellte zur Unterschrift unter verschlechterte Arbeitsverträge zu zwingen.
Dabei gäbe es durchaus auch positive Anknüpfungspunkte: Es ist im Moment praktisch Konsens, dass der Neoliberalismus doch nicht das Glück der Menschheit darstellt. Die Mehrheit der Weltbevölkerung weiß das schon längst, aber jetzt spricht es sich auch in den Industriestaaten verstärkt herum. Verstaatlichungen sind wieder denkbar, die „schwarze Null“ wurde praktisch über Nacht obsolet. Für all dies ließen sich linke Kämpfe ausfechten, wäre es höchste Zeit, sich in die Debatte einzuschalten und auch bzw. gerade in Krisenzeiten auf Mitsprache zu pochen. Wenn man denn demonstrieren, streiken, sich versammeln dürfte. Von daher ist nicht nur wichtig, sich für den Tag X, an dem man wieder hinausgehen darf, vorzubereiten, sondern auch, neue Formen von Protestmöglichkeiten weiterzuentwickeln – und vor allem, bis dahin nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern sich mit GenossInnen und KollegInnen auszutauschen, die politische Arbeit weiterzuführen, wo und wie immer es möglich ist. Die Herrschenden machen ja auch keine Pause.
Ulla Jelpke, MdB
Wir bedanken uns für die Nachdruckerlaubnis bei der Redaktion der Roten Hilfe Zeitung und der Autorin