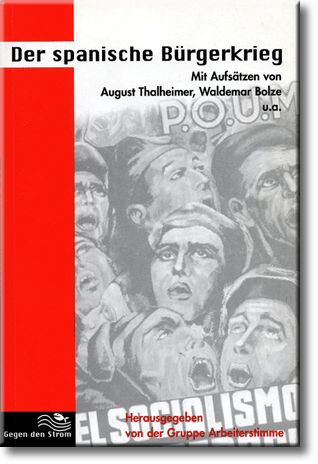Stärkste Kraft im Osten: AfD
Es war ein Paukenschlag. In ganz Ostdeutschland liegt die AfD bei den zurückliegenden Bundestagswahlen weit über dem Bundesdurchschnitt. In Sachsen schafft sie es sogar auf den ersten Platz. Die AfD erreicht hier 24,6 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen. Bei den Erststimmen liegt sie sogar noch darüber. Hier sind es 25,7 Prozent. Von insgesamt 16 Direktmandaten erhält sie damit 10. Bei den Wahlen 2017 waren es nur drei Mandate. Für die CDU kam das Wahlergebnis bei den zurückliegenden Wahlen einem Desaster gleich. 2017 hatte sie noch 12 Direktmandate. Jetzt sind es nur noch 4.
Es scheint so, als würden in Sachsen die Wähler anders ticken als im Rest der Republik. Die Zahlen klaffen im Vergleich zu anderen Bundesländern teilweise weit auseinander. Im Freistaat Sachsen hat die AfD klar vor der CDU die Wahl gewonnen, die Grünen liegen knapp über der Fünf-Prozent-Grenze. Bei den Zweitstimmen konnte die SPD deutlich zulegen. Im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl liegt sie auf Platz zwei - noch vor der CDU in Sachsen. Auch die Linke verliert dramatisch. Sie kommt auf 9,3 Prozent und verliert demnach gegenüber den vorangegangenen Bundestagswahlen 6,8 Prozentpunkte an Wählerstimmen.
Die AfD hat bei der Bundestagswahl in Sachsen vor allem auf dem Land viele Stimmen geholt. In den Städten Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Dresden lag sie allerdings deutlich hinter diesen Ergebnissen. Hier konnte sie auch keine Direktmandate holen.
Das beste prozentuale Ergebnis bei den Zweitstimmen bekam die AfD in Görlitz, dem Wahlkreis ihres Bundessprechers Chrupalla. Dort kommt sie auf 32,5 Prozent der Stimmen. In vielen Ortschaften dieses Wahlkreises lag die Partei bei den Zweitstimmen bei mehr als 40 Prozent. So sind es in der Gemeinde Neißeaue 47,4 Prozent!
Was zieht die Menschen zur AfD?
Über diese Frage wird schon längere Zeit in den Medien gerätselt. Warum wählen in Sachsen 15 Prozent der unter 25-Jährigen die AfD - im Bundesdurchschnitt waren es nur halb so viele? Warum ist diese Partei ausgerechnet für die Arbeitslosen und Arbeitern so attraktiv? Fragen über Fragen, auf die es sicherlich keine einheitliche und abschließende Antwort gibt
Diktatursozialisiert
Für den Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), dagegen scheint die Sache klar zu sein. Er sieht bei vielen Ostdeutschen eine „vertiefte Grundskepsis“ gegenüber der Demokratie. Auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gäbe es Unterschiede in der politischen Haltung zwischen Ost und West. „Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise (…) diktatursozialisiert sind“, so Wanderwitz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Daraus resultiere, dass die Ostdeutschen anfälliger sind für rechtsradikale Parteien. „Das ist zwar eine Minderheit, aber die Minderheit ist größer als in den alten Bundesländern“, sagte der CDU-Politiker der DPA. Ein Teil der Bevölkerung habe „gefestigte nichtdemokratische Ansichten“.
Wanderwitz stellt dann in seinem „Bericht Deutsche Einheit“ immerhin fest, dass der Osten wirtschaftlich noch immer dem Westen hinterherhinkt. Betrachten wir deshalb die ostdeutsche bzw. die sächsische Industrie genauer und kommen damit der Frage näher.
Es wurde abgewickelt
Derzeit gibt es in Sachsen 111.500 Unternehmen. Davon haben 98 Prozent weniger als 1.000 Beschäftigte. Das bedeutet, die sächsische Industrie besteht überwiegend aus kleinen „Krautern“. Das ist ein Strukturproblem, das schwer zu beseitigen ist. Nach der Übernahme der DDR-Betriebe durch westdeutsche Konzerne und mittelständische Unternehmen sind deren Firmenzentralen im Westen geblieben und die Standorte im Osten wurden im Grunde zu deren verlängerten Werkbänken. Aber immerhin gibt es sie noch. Viele DDR-Betriebe verschwanden aber durch die Politik der Treuhandanstalt und Bundesregierung für immer von der Bildfläche. Sie gingen in Konkurs, wurden stillgelegt oder an überwiegend westdeutsche Kapitalisten verscherbelt. So wurde aus Sachsen, der Wiege des deutschen Maschinenbaus und der Textilindustrie, ein unterindustrialisiertes Bundesland mit vorherrschend kleinindustrieller Struktur. Das war von der Bundesregierung und dem westdeutschen Kapital so gewollt. Die Industrie der DDR sollte in eigenständiger Form nicht überleben, um nicht als Konkurrent gegen westdeutsche Konzerne auftreten zu können. So wurde Sachsen, eine hochindustrialisierte Region, abgewickelt, wie die ganze DDR abgewickelt wurde. An diesem Umstand leidet der Osten Deutschlands heute noch und daraus resultiert letzten Endes die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, die sich auch in den vorliegenden Wahlergebnissen ausdrückt.
„Blühende Landschaften“
Im Jahr 1990 hat der damalige Kanzler Helmut Kohl im Bundestagswahlkampf den Ostdeutschen „blühende Landschaften“ binnen weniger Jahre versprochen. Betrachtet man heute die Städte im Osten, scheint das Versprechen eingelöst. Überall wurde neu gebaut und Altes renoviert. Aber das ist nur der Schein und der trügt bekanntlicherweise nicht selten. Durch die Abwicklung der DDR-Industrie sind heute die wirtschaftlichen Unterschiede erheblich. Zwar gibt es beispielsweise in Sachsen neue Industrieansiedlungen westdeutscher Automobilkonzerne und der Halbleiterindustrie, doch beeinflussen diese die kleinteilige Industriestruktur nur wenig. Das gilt insbesondere für die Einkommenssituation der ostdeutschen Werktätigen. In den Jahren 1991 bis 1996 erfolgte die erste Angleichung an das westdeutsche Entgeltniveau. Die Entgelte stiegen im Durchschnitt von 42 Prozent auf 67 Prozent. In dieser Epoche liefen die meisten Unternehmen noch unter der Regie der Treuhandanstalt. Und man kann deshalb die „großzügigen“ Entgelterhöhungen gewissermaßen als Zugeständnis der Politik an die Werktätigen betrachten. Damit sollte die Abwicklung der DDR-Industrie relativ konfliktfrei ablaufen – was schließlich auch gelang. In den Folgejahren kam dann die Entgeltangleichung ins Stocken. Der Wert stieg nur noch geringfügig auf heute ungefähr 75 Prozent.
Der Osten wird abgehängt
Im Westen erhielten sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte 2019 ein mittleres Einkommen von 3.526 Euro brutto, in Ostdeutschland waren es 2.827 Euro. Das Entgelt in Westdeutschland lag somit um 24,7 Prozent höher als das der Ostdeutschen (Quelle: mdr, 14. März 21).
Das ist der Durchschnittswert. Betrachtet man aber die einzelnen Branchen, dann werden die Unterschiede noch krasser. So liegen die Entgelte beispielsweise in der Bekleidungsindustrie um 73 Prozent unter denen des Westens. Beim Auto-, Motoren-, Karosserie-, Anhänger- und Autoteilebau werden im Westen rund 45 Prozent höhere Entgelte bezahlt. Ebenso im Bereich des Maschinenbaus. Hier liegen die Entgelte im Westen um rund 44 Prozent über denen des Ostens.
Eine wichtige Ursache für die Entgeltunterschiede ist die deutlich geringere Tarifbindung in Ostdeutschland. Die entstand jedoch nicht zufällig. Sie wurde bewusst von den Unternehmern und ihren Verbänden vorangetrieben. Anfang der 90er Jahre waren praktisch alle Treuhandbetriebe tarifgebunden und die Belegschaften zu großen Teilen gewerkschaftlich organisiert. So konnte die IG Metall in Sachsen sogar einen dreiwöchigen Arbeitskampf führen, nachdem der sächsische Metallarbeitgeberverband die tarifliche Entgeltvereinbarung aufkündigte und diesen schließlich zwingen, sich an eine Angleichungs-Vereinbarung zu halten.
Mit der zunehmenden Privatisierung der Treuhandbetriebe ändert sich auch die relative Stärke der Gewerkschaften. Die neuen Besitzer der Unternehmen zeigten den Belegschaften, wer der „Herr im Hause“ ist. In den meisten Fällen kam es zu organisatorischen Veränderungen, verbunden mit Abgruppierungen und Personalabbau. Auch kam es zu rechtswidriger Tarifflucht. Die „Herren“ hielten sich einfach nicht mehr an den Tarifvertrag und machten Stimmung gegen die Gewerkschaften. Und die Belegschaften samt ihrer Betriebsräte nahmen das in den meisten Fällen hin. In einem Umfeld, geprägt von Massenarbeitslosigkeit, waren offensichtlich viele Werktätige bereit, an ihrem Arbeitsplatz Verschlechterungen hinzunehmen, wenn ihnen dieser dann im Gegenzug erhalten blieb. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Gewerkschaften. Sie mussten zum Teil massive Mitgliederverluste hinnehmen.
Ein weiterer Mitgliedereinbruch – vor allem für die IG Metall – erfolgte im Jahr 2003. In dem Jahr versuchte die IG Metall durch einen Streik die Angleichung der Arbeitszeit im Osten durchzusetzen. Der Arbeitskampf wird zum Trauma für die Gewerkschaft. Deren Gegner sind nicht nur wild gewordene Unternehmer, die mit allen Mitteln den Streik brechen wollen, sondern so gut wie alle Medien, die Presse und große Teile der Politik. Sie schießen aus allen Rohren gegen die IG Metall und die Streikenden. Nach Meinung des sächsischen Ministerpräsidenten war der Streik damals gegen den „Aufbau Ost“ gerichtet. Auch Kanzlerin Merkel mischte sich ein. Für sie ging „die Entwicklung angesichts der Gefährdung vieler Arbeitsplätze im Metallbereich in Ostdeutschland wirklich dramatisch in die falsche Richtung“ und sei „nah an einem Skandal.“
Nun kann man von einer Person wie Merkel im Grunde nichts anderes erwarten als diese dümmliche Mäkelei.
Etwas anderes allerdings ist es, wenn Betriebsräte und IG Metallfunktionäre über die Medien öffentlich in dieselbe Kerbe hauen. Dies geschah, als im Westen in der Automobilindustrie der Streik begann Wirkung zu zeigen und dort die ersten Bänder standen.
Der innergewerkschaftliche Konflikt eskalierte in der Folgezeit und schließlich bricht der damalige Vorsitzende Klaus Zwickel nach vierwöchigem Kampf den Streik ab. Eine noch nie dagewesene Maßnahme in der Geschichte der Metallgewerkschaft. Die Funktionäre und Streikenden erfahren davon über die öffentlichen Medien. Entsprechend sind die Reaktionen. Was folgt, ist eine Schlammschlacht sondergleichen innerhalb der Organisation und bei den ostdeutschen Werktätigen die Erkenntnis, dass man sich auch innerhalb der Gewerkschaft der Solidarität der westdeutschen KollegInnen und Gewerkschaftsstrukturen nicht sicher sein kann. Bei nicht wenigen IG Metall-Mitgliedern führte das zum falschen Rückschluss, die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften zu kündigen.
Schwache Gewerkschaften
Die Schwäche der Gewerkschaften zeigt sich heute auch am prozentualen Anteil der Beschäftigten, die in einem tarifgebundenen Betrieb arbeiten. Zwar hat die Tarifbindung in der ganzen BRD aufgrund der neoliberalen Offensive des Kapitals in den zurückliegenden Jahren abgenommen, aber in Westdeutschland liegt die Tarifbindung immerhin noch bei 57 Prozent (Stand: Mitte 2017). In Sachsen dagegen erhalten gerade noch 39 Prozent der Werktätigen eine Entlohnung nach einem Tarifvertrag. In den übrigen ostdeutschen Bundesländern sieht es ein wenig besser aus. Dort liegt die Tarifbindung im Durchschnitt bei 46 Prozent. Aber mit 39 Prozent sind die Sachsen mit Abstand das Schlusslicht in Deutschland.
In engem Zusammenhang mit dem Problem der Tarifbindung steht das Problem der betrieblichen Interessenvertretung. Viele, vor allem kleine und mittlere Betriebe, sind betriebsratslos. Und dort, wo Beschäftigte einen Betriebsrat gründen wollen, wird eine Wahl oft mit kriminellen Mitteln behindert und häufig auch verhindert. Union Busting ist eine gängige Erscheinung. Nach Aussagen des DGB Bezirks Sachsen ist davon jede dritte Initiative zu einer Betriebsratswahl betroffen. Gibt es in einem Betrieb keinen Betriebsrat, hat das nicht nur die Konsequenz, dass die Beschäftigten schutzlos der Willkür eines Unternehmers ausgesetzt sind, sondern auch, dass der Betrieb für eine Gewerkschaft schwer erreichbar ist. Für eine Gewerkschaft ist der Betriebsrat der Zugang zum Betrieb. Über ihn erreicht sie ihre Mitglieder und kann neue Mitglieder gewinnen. Über ihn hat sie die Möglichkeit, die Belegschaft auf Betriebsversammlungen zu agitieren und auf eine Tarifauseinandersetzung vorzubereiten. Fehlt die Grundvoraussetzung „Betriebsrat“, heißt das:
kein Betriebsrat – keine Gewerkschaft – kein Tarifvertrag!
Es hat sich nichts geändert
Der MDR versuchte am Tag nach der Bundestagswahl eine Erklärung für den Wählererfolg der AfD in Sachsen zu finden. Unter anderem interviewte er einfache Menschen auf Sachsens Straßen. Eine Frau aus Delitsch meinte: „Die Leute wollen, dass sich etwas ändert. Deshalb haben sie die AfD gewählt - nicht, weil die so toll ist, sondern weil sich einfach etwas ändern soll“. Und ein Passant in Crostwitz in der Oberlausitz sagt:: "Innerhalb von 30 Jahren hat sich seit der Wende für den Osten nichts geändert. Lohnmäßig gar nichts“. Auf solche und ähnliche Meinungen trifft man in Sachsen und im ganzen Osten häufig. Sie sind geprägt von der sozialen Lage der dort lebenden Menschen. Sie verdienen noch immer deutlich weniger als Westdeutsche, haben längere Arbeitszeiten; die Renten sind niedriger und die Arbeitslosigkeit ist höher als im Westen. Eine Mehrheit der Menschen ist der Ansicht, dass es in Deutschland „eher ungerecht zugeht“.
Aus dieser sozialen Ungleichheit entsteht Frust und Wut. Und für viele scheint das einzige Mittel, dies zum Ausdruck zu bringen, zu sein, bei der Wahl das Kreuz bei der AfD zu machen. Man will es „denen da Oben“ zeigen.
Natürlich beruhen die Wahlerfolge der AfD nicht nur auf der sozialen Lage eines großen Bevölkerungsanteils in Sachsen und Ostdeutschlands. So ist beispielsweise in Sachsen die NPD im Jahr 2004 und 2009 in den Landtag eingezogen. Im Jahr 2004 erreichte sie mehr als 9 Prozent der Stimmen. Das zeigt, dass in den zurückliegenden fast 20 Jahren ein stabiler brauner Wählerstamm herangewachsen ist. Der ist inzwischen bei der AfD gelandet. Hinzu kommen diejenigen, die in den zurückliegenden Jahren die PDS bzw. die Linkspartei gewählt haben. Sie haben das politische Lager gewechselt, weil ihnen die Linke inzwischen zu etabliert ist, sich nicht wesentlich von den anderen Parteien unterscheidet.
Die Wähler der AfD, die aus dem Lager der Lohnabhängigen kommen, unterliegen einem großen Irrtum. Der besteht darin, dass sie meinen, es müsse jemanden geben, „der es für sie richtet“. Der dafür sorgt, dass die vorhandenen Defizite verschwinden, der für die Angleichung der Verhältnisse sorgt. Einen solchen „Jemand“ gibt es aber nicht und wird es nicht geben. Soll sich etwas zum Positiven verändern, kann das nur durch die Werktätigen selbst geschehen. Die Konfliktlinien laufen nämlich nicht zwischen Ost und West, zwischen Deutschen und Migranten, sondern immer noch zwischen Kapital und Arbeit. Will man höhere Entgelte und damit die Angleichung an Westverhältnisse, muss man die Unternehmer im Osten dazu zwingen. Dasselbe gilt für kürzere Arbeitszeiten, für Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Wie das geht, hat die zurückliegende Tarifrunde der IG Metall gezeigt. Nach mehreren 24-Stunden Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie wurde vereinbart, dass betrieblich über die Arbeitszeit verhandelt wird. Erste Ergebnisse liegen jetzt vor. In allen Automobilbetrieben in Sachsen ist inzwischen der Einstieg in die 35-Stundenwoche vereinbart. Ohne solidarisches, gemeinsames Handeln der Belegschaften wäre das nicht geschehen. Das gleiche gilt auch für die Erfolge der NGG bei den Firmen „Bautzener Senf“ oder „Teigwaren Riesa“. Auch dort gibt es heute Tarifverträge, die die Lücke zum Westlohnniveau schließen. Auch dort war es nur durch den Druck der Belegschaft möglich, die sich in ihrer großen Mehrheit entschlossen hatte, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Durch diese positiven Beispiele werden die sozialen Verhältnisse in Sachsen natürlich nicht grundsätzlich verbessert. Aber immerhin zeigen diese Beispiele, dass Veränderungen möglich sind. Nichts muss bleiben wie es ist. Und sicherlich sind sich die Gewerkschaften dessen auch bewusst und arbeiten weiter in mühseliger Kleinarbeit daran, möglichst viele KollegInnen zu erreichen und zu organisieren. Sind sie in dieser Arbeit erfolgreich, hat das Auswirkungen auf das Bewusstsein der Werktätigen. Erfolge einer Belegschaft, gemeinsam errungen mit ihrer Gewerkschaft gegen ein mächtiges Unternehmen, steigern das Selbstwertgefühl und den Zusammenhalt der abhängig Beschäftigten. Und sicherlich verändert sich ihr Blick auf die AfD. Ihre soziale Demagogie nicht mehr wirksam sein.