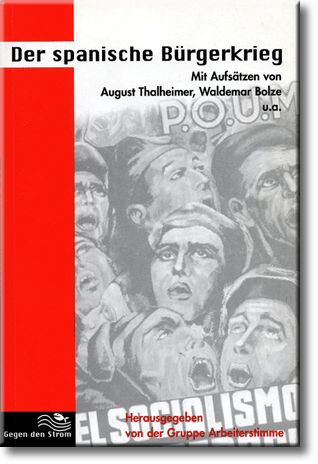Für den Oktober 2022 wurde eine Preissteigerungsrate von 10,4 % gemeldet. Damit hat sich die Inflation mit Macht zurückgemeldet. Einen so hohen Wert hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben. Die Lohnabhängigen sind dadurch starken Reallohnverlusten ausgesetzt. Denn die bisherigen Abschlüsse der Gewerkschaften können solch hohe Preissteigerungen nicht ausgleichen. Problematisch ist die Situation vor allem für Beschäftigte im Niedriglohnsektor und für andere Personen mit niedrigen Einkommen. Denn von den Preissteigerungen sind ganz besonders Produkte betroffen, die zur Basisversorgung gehören und deshalb unverzichtbar sind, wie z.B. Lebensmittel oder Heizenergie.
Wenn im folgenden von Inflationsraten und Preissteigerungen die Rede ist, bezieht sich das auf die offiziellen Statistiken. Diese werden erstellt unter Verwendung von Warenkörben, die das durchschnittliche Einkaufsverhalten der Gesellschaft abbilden sollen. Über die Zusammensetzung der Warenkörbe und darüber, ob sie wirklich repräsentativ sind, lässt sich streiten. Außerdem ist die Lebenswirklichkeit von einzelnen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich. Eine Familie mit kleinen Kindern kauft andere Waren als ein Singlehaushalt, Kleinverdiener andere als Großverdiener, die Mieten in Ballungsgebieten steigen schneller als in ländlichen Gegenden, usw.. Die Statistik weist aber grundsätzlich nur einen Durchschnitt aus, der die besondere Betroffenheit einzelner Gruppen kaschieren kann. Trotzdem wird mit den Statistiken gearbeitet, nicht weil man sich dieser Problematik nicht bewusst wäre, sondern weil keine besseren Daten zur Verfügung stehen.
Mit dem rasanten Anstieg der Inflationsraten geht eine längere Periode mit relativer Preisstabilität zu Ende. Denn in den letzten Jahrzehnten zeigten die Statistiken für Deutschland und auch für viele andere Länder relativ geringe jährlichen Preissteigerungsraten an. Das war ein Charakteristikum dieser Zeit. Mancher Kommentator hat wegen dieser Erfahrung schon von einem Verschwinden der Inflation oder gar von einem Sieg über sie gesprochen. Fast alle Notenbanken setzen sich ein Inflationsziel von 2%. (Auf die Frage, warum gerade 2% bzw. nach Sinn oder Unsinn eines solchen Ziels, kann hier nicht weiter eingegangen werden.) Tatsache war es aber, dass in vielen Ländern und für etliche Jahre dieses 2%-Ziel nicht erreicht wurde, die Preissteigerungen blieben darunter.
Nicht vergessen sollte man allerdings, dass das keineswegs für alle Länder zutrifft. Im wesentlichen war die niedrige Inflationsrate auf die alten Industrieländer in den kapitalistischen Zentren beschränkt. In den sogenannten Schwellenländern war die Situation zum Teil deutlich anders. Eklatante Gegenbeispiele sind etwa Argentinien oder die Türkei.
In den Medien wird den Aktivitäten der Notenbanken, deren Geldpolitik und ihren Inflationszielen große Bedeutung beigemessen. Vielfach wird die Meinung vertreten, sie hätten vor allem für den Erhalt der Preisstabilität zu sorgen und sie könnten das auch, wenn sie nur entschlossen genug handeln würden. Diese Ansicht wird im folgenden hinterfragt. Deshalb wird etwas genauer auf die Thematik eingegangen.
Besonders die Zeit nach der Finanzkrise von 2008 ist in Hinblick auf die Inflation interessant. In der Krise erfolgte ein genereller Schwenk hin zu einer sehr expansiven Geldpolitik. Viele Notenbanken und insbesondere die drei weltwirtschaftlich wichtigsten, zuständig für Dollar, Euro und Yen, senkten die Leitzinsen, bis sie bei Null oder nahe Null angelangt waren. Aber im Detail gab es durchaus Unterschiede zwischen den Notenbanken. Manche wie etwa die FED in den USA handelten sehr zügig und erreichten Ende 2008 (zum ersten Mal) das 0,0 %-Niveau, andere wie die EZB senkten den Leitzins viel langsamer und kamen erst 2014 bei 0,5% und 2016 bei 0,0 % an. Einige Notenbanken, darunter auch die EZB, erhoben zeitweise für die bei ihr gehaltenen Guthaben einen negativen Zins. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der Leitzinssenkung anscheinend als zu wenig wirksam eingeschätzt. Denn die Notenbanken griffen zusätzlich noch zu einer weiteren Maßnahme, die vor der Finanzkrise nie eingesetzt wurde und auch in gewisser Weise tabuisiert war, dem sogenannten „Quantitative Easing“ (= quantitative Lockerung). Darunter versteht man den massiven Kauf von Wertpapieren, meistens von Staatsanleihen, durch die Notenbanken. Die Geldmittel für den Kauf der Wertpapiere werden von den Notenbanken durch Geldschöpfung bereitgestellt. Der Vorgang ist also mit einer entsprechend massiven Ausdehnung der im Umlauf befindlichen Geldmenge verbundenen.
Während der akuten Krise ging es den Notenbanken vor allem darum, die Liquidität der Banken und innerhalb des Finanzsektors sicherzustellen. Ein Abbruch von Zahlungsketten, der zu einer akuten Krisenverschärfung geführt hätte, sollte unter allen Umständen verhindert werden. Ein weiteres Ziel war es, die durch die Krise ausgelöste Rezession zu bekämpfen. Die lockere Geldpolitik sollte zur Ankurbelung der Konjunktur beitragen. Denn in der Zeit nach 2008 gab es vielfach die Befürchtung, die Weltwirtschaft könnte in eine große Deflation abgleiten.
Diese sehr lockere Geldpolitik wurde über etliche Jahre beibehalten, auch als die meisten akuten Krisenerscheinungen abgeklungen waren und sich wieder ein (mäßiges) Wachstum des BIP eingestellt hatte. Die US-amerikanische Notenbank (FED) versuchte ab 2016 einen Ausstieg aus dieser lockeren Geldpolitik und begann den Leitzins langsam anzuheben (und reduzierte gleichzeitig ihr Programm der Wertpapierkäufe). Dieser Versuch wurde 2020 wieder abgebrochen. Der Hauptgrund dafür war der Einbruch der Konjunktur wegen der Corona-Pandemie. Dagegen wurde von anderen Notenbanken, darunter auch der EZB, Wachstum und Konjunktur anscheinend noch nicht als wirklich gefestigt eingeschätzt. Deshalb hielten sie an ihrer lockeren Geldpolitik bis in die jüngste Vergangenheit fest. Am 21. Juli 2022 erhöhte die EZB zum ersten Mal wieder den Leitzins von 0,0 auf 0,5 %. Inzwischen wurden nach zwei weiteren Schritten 2 % erreicht. Für die EZB-Sitzung am 15. Dezember 2022 wird eine weitere Anhebung erwartet.
Die Folge der Geldpolitik der Notenbanken waren niedrige Zinsen bei Krediten. Entsprechendes galt auch für die Einlagen der Sparer, deren Zinsen lagen auch bei Null oder für größere Einlagen gar im negativen Bereich. Die niedrigen Zinsen sollten die Investitionen anregen, was aber im produktiven Sektor der Realwirtschaft nur in begrenztem Ausmaß geschehen ist.
Das heißt aber nicht, dass die niedrigen Zinsen keine Auswirkungen gehabt hätten. Einmal gab es große Geldzuflüsse in den Immobilienbereich, was zu einem regelrechten Immobilienboom mit starken Preissteigerungen führte. Weiterhin kam es zu einem Börsenboom. Nach dem Einbruch in der Finanzkrise erlebten die Aktien eine über Jahre anhaltende Aufwärtsentwicklung. Unterbrochen durch einen heftigen, aber kurzen Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie ging der Börsenboom bis Januar 2022 weiter. Offensichtlich floss sehr viel Geldkapital, verstärkt durch geliehenes Geld, an die Börsen, um dort Rendite zu erzielen. Eine solche Rendite ist natürlich im wesentlichen spekulativ und nicht Ausdruck eines echten Wertzuwachses.
Ein wichtiger Effekt der niedrigen Zinsen ist auch die Entlastung bei den Zinszahlungen für die öffentlichen Schulden. Die Staaten konnten zu sehr günstigen Konditionen Mittel aufnehmen. Bei Ländern mit guten Bonitätsnoten, wie etwa auch der Bundesrepublik, konnte das sogar bedeuten, dass sie durch das Aufnehmen von weiteren Schulden nicht nur keine zusätzlichen Zinsen zu bezahlen hatten, sondern auch noch einen (kleinen) Überschuss erzielten. Da die von den Staaten ausgegebenen Anleihen zu verschiedenen Zeiten (mit entsprechend unterschiedlichem Zinsniveau) erfolgen und unterschiedliche Laufzeiten haben, schlägt das Sinken (wie natürlich auch das Steigen) des Zinsniveaus nur mit Verzögerung auf die zu leistenden Zinszahlungen durch. In der langen Zeitspanne mit Niedrigzinsen konnten die Staaten aber die zu leistenden Zinszahlungen kontinuierlich verringern, was eine bedeutende Entlastung für die Staatshaushalte darstellte. Wirklich gelöst wird die Schuldenproblematik durch diesen Effekt selbstverständlich nicht.
Trotz der lockeren Geldpolitik blieb der Anstieg der Lebenshaltungskosten gering. Unter Ökonomen wurde heftig darüber diskutiert, worin diese relative Preisstabilität begründet ist. Denn die vorherrschende Meinung bei bürgerlichen Ökonomen besteht darin, dass Inflation eng an die Geldmenge gekoppelt ist (das ist eine der Hauptthesen der Monetaristen). Die Geldmenge hatte sich aber unzweifelhaft durch die lockere Geldpolitik erhöht. Doch es kommt entscheidend darauf an, was mit der im Umlauf befindlichen Geldmenge in der Realität passiert. Die ausgedehnte Geldmenge kam aber bei der „normalen“ Durchschnittsbevölkerung nicht an. Diese hatte keinen Zugriff auf und keine Verfügung über die zusätzlichen Gelder. Sie hat ihre Kreditaufnahme nicht im großen Maßstab gesteigert und auch keine besonderen Lohnerhöhungen erhalten. Deshalb stand ihr auch keine größere Kaufkraft zu Verfügung, es gab keine gesteigerte Nachfrage nach den typischen Produkten für das tägliche Leben. Eine gesteigerte Nachfrage wäre aber eine Grundvoraussetzung für Preiserhöhungen im Rahmen einer von der Nachfrage induzierten Inflation gewesen. Die gesteigerte Geldmenge ist offensichtlich hauptsächlich im Finanzbereich verblieben. Nur die wohlhabenden, reichen Schichten, die in der Lage sind, im Finanzsektor größere Geschäfte zu tätigen, haben direkt oder indirekt diese Mittel eingesetzt und damit die genannten Folgen (Immobilien-, Aktienboom) verursacht.
Bei der Entwicklung der Lebenshaltungskosten in den vergangenen Jahren war nicht die Nachfrage, sondern das Angebot entscheidend. Das ist der Schlüssel zum Verständnis des Inflationsgeschehens in dieser Zeit. Auch die entscheidenden Veränderungen, die die jüngsten Preissteigerungen auslösten, lagen auf der Angebotsseite.
Im Jahre 2021, also noch vor dem Ukraine-Krieg, begann sich die Situation zu ändern. Die Preise zeigten wieder eine stärkere Tendenz nach oben, um dann 2022 in einen massiven Inflationsschub überzugehen, mit Preissteigerungsraten von über 10 %. Etwas, was es schon lange nicht mehr gegeben hatte. Wie ist das zu erklären ?
Ein wesentlicher Grund ist selbstverständlich der Anstieg der Energiekosten, der sich durch den Ukraine-Krieg, durch die Sanktionen und die deswegen ausbleibenden russischen Energielieferungen erklären lässt. Dabei geht es nicht nur um die direkten Energiekosten, also die Preise, die direkt für Gas, Strom und Benzin an der Tankstelle oder an die Versorger bezahlt werden. Energie wird überall in der Produktion gebraucht und ist in fast allen Produkten, mal mehr mal weniger, enthalten. Dieser indirekte Beitrag der Energie zu den Preissteigerungen dürfte insgesamt größer sein als der direkte.
Die Energiekosten sind ohne Zweifel ein wichtiger Faktor, aber allein nicht ausreichend als Erklärung. Ein Beleg dafür ist der Beginn der Preissteigerungen schon vor dem Februar 2022. Ein weiterer Beleg ist die Situation in den USA. Hier hat ebenfalls die Inflation drastisch angezogen, aber höhere Energiekosten spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Denn die USA haben nur wenig russische Energieträger importiert, eigentlich nur etwas Erdöl und Erdölprodukte. Für diese gab es auch nur vorübergehend einen Anstieg der Preise auf dem Weltmarkt. Inzwischen (Nov. 22) sind die Preise für Erdöl in etwa wieder auf das Niveau wie vor Kriegsbeginn gefallen.
Ein weiterer wichtiger Faktor hängt mit der Globalisierung zusammen. Der Import einer immer größer werdenden Anzahl von End- und Vorprodukten zu günstigen Preisen aus Ländern mit sehr niedrigen Löhnen war eine wesentliche Ursache für die relative Preisstabilität der letzten Jahrzehnte. Es wurden nicht nur Waren importiert, sondern auch stabile Preise. Diese Jahrzehnte waren auch die Zeit mit einem ausgeprägten Globalisierungsschub. China spielte bei der Globalisierung die größte Rolle, dort sitzen die meisten Lieferanten und von dort kommen die meisten Produkte, aber es ist selbstverständlich nicht das einzige Land, das in die globalen Lieferketten einbezogen ist.
Inzwischen scheint aber das Potenzial der Globalisierung weitgehend ausgeschöpft zu sein. Es gibt Anzeichen dafür, dass die mit der Globalisierung verbundenen Vorgehensweisen und Methoden allmählich an eine Grenze stoßen. Eine Rolle dürfte dabei die Tendenz zu höheren Löhnen in China spielen. Ein anderes Beispiel sind die immer komplexer und länger werdenden Lieferketten. Ihre ständige Ausdehnung erhöht die Anfälligkeit für Störungen aller Art, generiert aber kaum mehr zusätzlichen Nutzen. Diese Anfälligkeit ist während der Pandemie mit ihren Unterbrüchen in der Produktion bzw. beim Transport mehrfach demonstriert worden.
Es ist davon auszugehen, dass spätestens mit dem Beginn der Pandemie, eventuell auch schon früher, das energische Vorantreiben der Globalisierung ausgelaufen ist. Dadurch kam auch die stabilisierende Wirkung auf die Preise zu einem Ende. Dieses generelle Nachlassen der die Preise dämpfenden Wirkung überlappte sich zeitlich mit der von der Corona-Pandemie ausgelösten akuten Krise. Lockdowns und andere Maßnahmen führten zu einer massiven Störung der Lieferketten und des wirtschaftlichen Ablaufs. Es kam zu einer Verknappung vieler Produkte, die die folgenden Preiserhöhungen möglich machte.
Kurz nach dem Höhepunkt der Corona-Krise brachte der Ukraine-Krieg weitere Marktturbulenzen. Neben dem Schwerpunkt bei den Energie- und besonders Gaspreisen sind auch noch andere Produkte betroffen, etwa Getreide und Mehl, Sonnenblumenöl, Aluminium, Kunstdünger und einige andere.
Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Ursache für die Preissteigerungen. Nämlich das generell vorhandene Bestreben der Kapitalisten, die Gewinnspanne bei ihren Waren zu erhöhen. Marktturbulenzen sind eine günstige Gelegenheit für Preiserhöhungen, auch für solche, die in keiner Weise mit erhöhten Kosten zu begründen sind. Ein erheblicher Anteil der Preissteigerungen dürfte auf Mitnahmeeffekten beruhen.
Der Vollständigkeit wegen sei noch angemerkt: In den USA ist die Situation vielleicht etwas anders als in Europa. Hier gab es im Rahmen der Bekämpfung der „Corona-Rezession“mehr staatliche Maßnahmen, die die Massennachfrage stimulierten. In Japan ist die Situation wieder anders. Die Inflationsrate hat hier die 3 vor dem Komma noch nicht überschritten und das bei einer ausgesprochen lockeren Geldpolitik und sehr hoher Staatsverschuldung.
Das ungefähre zeitliche Zusammentreffen von mehreren, nicht direkt zusammenhängenden Ursachen kompliziert die Situation und erschwert die Analyse. Beim aktuellen Inflationsschub haben wir es mit zwei Angebotsschocks (Lieferkettenproblematik, Krieg und Sanktionen) und einem eher langsam wirkenden Effekt (Auslaufen des Globalisierungsschubs) zu tun. In den Medien wird vielfach die Auffassung propagiert, der Hauptgrund für die Preissteigerungen wäre die lockere Geldpolitik und die damit zusammenhängende Geldmengenausdehnung. Deswegen sei ein energisches Dagegenhalten der Notenbanken mit entsprechenden Leitzinserhöhungen unbedingt notwendig.
Das wäre richtig, wenn die Ausdehnung der Geldmenge zu einer allgemeinen Hochkonjunktur in der Realwirtschaft geführt hätte, zu einem bedeutenden Anstieg der Nachfrage und dadurch ausgelösten Preiserhöhungen. Einen Boom gab es aber nur bei Vermögensanlagen wie Aktien und Immobilien. Ein genereller Anstieg der Nachfrage hat dagegen nicht stattgefunden. Durch welche Mittel hätte denn auch eine erhöhte Nachfrage ausgelöst werden sollen? In der Realität war es doch so, dass während der Zeit mit einigermaßen stabilen Preise viele finanziell noch einigermaßen über die Runden kamen. Deren bisheriger, sowieso nicht üppiger Lebensstandard ist jetzt bei den hohen Preisen gefährdet. Die geplanten staatlichen Entlastungen sind deshalb bitter notwendig.
Oft wird der Eindruck erweckt, die Instrumente der Notenbanken, hauptsächlich die Festlegung des Leitzinses, wären ein probates Mittel, um gegen Preissteigerungen vorzugehen und vielleicht sogar generell die Wirtschaft zu steuern. In Wirklichkeit ist das nicht so. Den Notenbanken stehen nur grobe Instrumente zur Verfügung, die meistens nur über Umwege wirken und mit unerwünschten Nebenwirkungen verbunden sind. Die Notenbanken haben keine Möglichkeit, gezielt etwas gegen Angebotsverknappungen wie reduzierte Gaslieferungen oder gestörte Lieferketten zu unternehmen. Bei der Inflationsbekämpfung laufen ihre Möglichkeiten mehr oder weniger auf die Herbeiführung einer Rezession hinaus. Eine Rezession hat dann irgendwann natürlich auch Auswirkung auf die Preise, aber eben mit sehr vielen Nebenwirkungen.
Inzwischen haben fast alle Notenbanken (eine Ausnahme ist Japan) einen Kurswechsel in der Zinspolitik zum Zwecke der Inflationsbekämpfung vollzogen. Die zu zahlenden Zinsen steigen für alle Kreditnehmer signifikant an. Das hat vielfältige Auswirkungen.
Verteuert werden tendenziell auch alle Investitionen, sei es in den Wohnungsbau, den notwendigen Umbau der Energiewirtschaft, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder Verbesserungen der (oft marode gewordenen) Infrastruktur. Hohe Zinsen werden Investitionen weiter hinauszögern oder gar verhindern. Aber jeder weiß, eigentlich wären in den genannten Bereichen in Zukunft sehr große, um nicht zu sagen gigantische Investitionen erforderlich.
Hohe Zinsen können Firmen in Bedrängnis bringen, insbesondere die, die auch schon bisher Probleme hatten bzw. wegen der Energieverteuerung jetzt Probleme bekommen werden. Hohe Zinsen werden die Überlebensfähigkeit der sogenannten „Zombie-Firmen“, die nur durch die Inanspruchnahme von sehr günstigen Krediten noch nicht insolvent geworden sind, endgültig beenden. Wie viele solcher Firmen es gibt, ist umstritten, manche Ökonomen gehen von über 10% aller Firmen aus.
Für die Staaten kommt das Ende der günstigen Finanzierung. Es müssen wieder mehr Haushaltsmittel aufgewendet werden, um die fälligen Zinsen zu zahlen. Da fast alle Staaten hoch verschuldet sind, - es gibt nur graduelle Unterschiede -, ist das ein erheblicher Effekt. Wegen der Zinsbindungen wird diese Veränderung zwar erst nach und nach wirksam werden, aber bei einem dauerhaften Zinsanstieg ist sie letztlich unvermeidlich.
Besonders im sogenannten globalen Süden haben viele Länder Auslandsschulden in Dollar. Sie sind deshalb von einem Zinsanstieg im Dollarbereich betroffen. Zusätzlich werden sie auch noch durch den etwa seit Jahresbeginn gestiegenen Kurs des Dollars belastet. Wegen der internationalen Bedeutung des Dollars macht die US-amerikanische Notenbank nicht nur Geldpolitik für den Binnenmarkt der USA, sondern in gewisser Weise Geldpolitik im Weltmaßstab.
Nicht zuletzt sind auch die Finanzmärkte betroffen. Während die niedrigen Zinsen den dortigen Boom begünstigt haben, sind von hohen Zinsen bremsende Effekte zu erwarten. Im Prinzip könnte man eine Bremswirkung auf die Finanzmärkte als eine positive Nebenwirkung betrachten. Beim heutigen Zustand der Finanzmärkte ist allerdings auch mit echten Gefahren zu rechnen. Wenn Geschäfte, die auf der Basis von niedrigen Zinsen abgeschlossen wurden, jetzt bei einem deutlich höheren Zinsniveau refinanziert werden müssen, kann das zu ernsthaften Problemen führen. Besonders riskante Geschäfte könnten auch platzen. Das stellt ein erhebliches Krisenpotential dar. Bekanntlich können die in den deregulierten Finanzmärkten getätigten Geschäfte sehr große Summen umfassen, sehr komplex sein, viele Beteiligte haben und mit Abhängigkeiten verbunden sein, die kaum zu durchschauen sind. Ein anfangs kleines und punktuelles Problem kann unter Umständen schnell zu einer Lawine anwachsen, die großen Schaden anrichtet. Oft werden die Probleme erst dann erkannt, wenn der Schaden bereits eingetreten ist. Auf jeden Fall bedeuten die Zinserhöhungen ein weiteres Element der Instabilität für Teile des Finanzsektors.
Bleibt noch die Frage, was in der Zukunft zu erwarten ist. Ist die Inflation vorübergehend oder wird sie sich dauerhaft einnisten? Momentan ist noch nicht abzusehen, wann der Ukraine-Krieg zu einem Ende kommen könnte und wie sich die ökonomischen Verhältnisse danach darstellen. Unsicherheit in einem erheblichen Ausmaß besteht also weiter.
In näherer Zukunft könnten sich die durch den Krieg ausgelösten Marktturbulenzen im Energiesektor beruhigen und die Preise sich wieder stabilisieren. Garantiert ist das aber nicht. Allerdings ist langfristig mit deutlich höheren Energiekosten zu rechnen. Energiepreise auf dem Niveau von 2021 gehören ziemlich sicher der Vergangenheit an.
Die anderen Faktoren, wie das Auslaufen der Globalisierungswelle, dürften auf Dauer wirksam bleiben. Die politischen und ökonomischen Bedingungen sprechen nicht dafür, dass sich ein Globalisierungsschub, wie er mit dem Aufstieg Chinas verbunden war, mit ähnlichen weltwirtschaftlichen Auswirkungen in absehbarer Zeit wiederholen könnte.
Für die Zukunft ist deshalb mit höheren Preissteigerungsraten zu rechnen als in den vergangenen Jahren, wenn auch nicht mit so hohen wie im Oktober 2022. Für 2023 und 2024 erscheint ein Rückgang der Inflationsraten auf deutlich unter 10% möglich. Äußerst fraglich ist allerdings, ob die Marke von 2% erreicht werden kann. Es sei denn, es kommt zu einer tiefen Rezession.