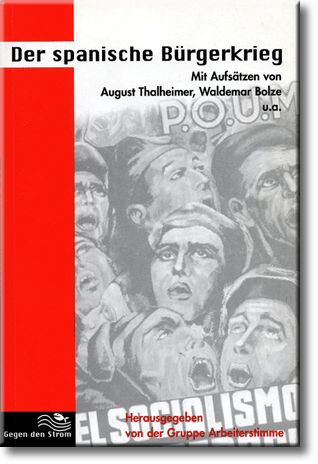Seit Bundeskanzler Scholz im Zusammenhang mit dem 100 Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr von einer „Zeitenwende“ gesprochen hat, erlebt dieses Wort eine Konjunktur. Unter Verweis auf den Krieg in der Ukraine wird jetzt für immer mehr Bereiche eine „Zeitenwende“ diagnostiziert.
Was immer man von diesem Schlagwort hält, der Ukraine-Krieg ist ohne Zweifel eine Zäsur, politisch und ökonomisch. Deutschland ist aus mehreren Gründen von dieser Zäsur besonders betroffen. Im folgenden soll deshalb versucht werden, die direkten und indirekten ökonomischen Folgen des Ukraine-Krieges etwas genauer zu untersuchen.
Der Fokus liegt dabei nicht auf dem kurzfristigen Krisenmanagement der Regierungen (wie z.B. „Gaspreisbremse“ und ähnliche Maßnahmen). Es geht vielmehr darum, die längerfristigen Auswirkungen für die Weltwirtschaft und besonders für Deutschland einzuschätzen.
Auch wenn kein direkter Bezug zum Ukraine-Krieg besteht, kann eine „Zeitenwende“ eingefordert werden. Unter dem propagandistischen Motto „Es gilt die Lehren aus der Abhängigkeit vom russischen Gas zu ziehen“ werden die zukünftigen ökonomischen Beziehungen zu China zur Diskussion gestellt. Die (potenziellen) ökonomischen Folgen einer zunehmenden Konfrontation mit China sind deshalb ebenfalls Thema dieses Artikels.
Dagegen werden die Auswirkungen auf die russische Wirtschaft nicht behandelt. Vor allem deshalb, weil es zur Zeit schwierig ist, dazu genügend zuverlässige Informationen zu erhalten.
Nur die realistische Einschätzung der Ausgangslage erlaubt die Beurteilung von Folgen. Deshalb erfolgt zuerst eine Beschreibung des Zustandes der kapitalistischen Weltwirtschaft einschließlich der Entwicklungen und Veränderungen, die bereits vor Beginn des Krieges und unabhängig von diesem zu beobachten waren.
Die Ausgangslage: eine kapitalistische Ökonomie mit gebremstem Wachstum und erhöhter Krisenanfälligkeit
Die kapitalistischen Zentren (USA, Europa, Japan) befinden sich schon seit längerem (seit ca. 1973/74) in einer Phase, in der die Kapitalakkumulation weit von früher (z.B. in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts) erreichten Zuwachsraten entfernt ist. Seitdem zeigte die Wirtschaft, aus Sicht des Kapitals, unbefriedigende Wachstumsraten. Unter den gegebenen Bedingungen war es anscheinend für Teile des angehäuften Kapitals schwierig, immer wieder geeignete Verwertungsbedingungen im (häufig stagnierenden) produktiven Sektor zu finden. Diese Kapitale verblieben tendenziell im Finanzsektor und suchten dort eine Rendite, oft mittels rein spekulativer Geschäfte.
Zusätzlich waren verschiedene Krisenerscheinungen ständig präsent bzw. lösten sich in dichter Folge ab. Zu nennen wären z.B. das Entstehen der hohen Sockelarbeitslosigkeit in den 70er Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch vorhanden, auch wenn sie nicht mehr kontinuierlich ansteigt. Dann gab es mehrere Perioden mit hohen Preissteigerungen (Höhepunkte auch in den 1970ern und jetzt wieder ganz aktuell). Es gab die Schuldenkrise in den 80er Jahren, die 1982 mit der praktischen Zahlungsunfähigkeit Mexikos begann und hauptsächlich lateinamerikanische Staaten betraf, die Asienkrise 1997 und vor allem, und bisher am tiefgreifendsten, die Finanzkrise von 2008.
In den Wirtschaftsstatistiken wird die Lage durch die relativ geringen Steigerungsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sichtbar. Die Investitionsraten sind ebenfalls vergleichsweise niedrig. Die Kapazitäten der Betriebe sind oft nicht voll ausgelastet. Es herrscht ein Zustand der latenten Überakkumulation.
Auch das Produktivitätswachstum ist im Vergleich zu früheren Perioden deutlich zurückgegangen. Das mag angesichts der vielen Berichte über die fortschreitende Digitalisierung und den Einsatz von Robotern überraschend sein, ist aber eine gut belegte Tatsache. Die Steigerungsraten der durchschnittlichen Arbeitsproduktivität sind in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. So gab es z.B. in Deutschland zwischen 2007 und 2019 nur einen durchschnittlichen Zuwachs von 0,6 Prozent der Wertschöpfung pro Erwerbstätigenstunde und pro Jahr. In früheren Zeiten lag diese Zuwachsrate um einiges höher (bis zu 3%). Deutschland ist kein Sonderfall. Die Zahlen für andere Industrieländer sind ähnlich.
Als Argument gegen die Diagnose einer kapitalistischen Wachstumsschwäche könnte man auf die Statistiken von Weltbank bzw. IWF verweisen, die für die letzten Jahrzehnte noch ein beachtliches Wachstum des globalen BIP ausweisen. Aber die Aussage über die Wachstumsschwäche bezieht sich in erster Linie auf die alten kapitalistischen Zentren. Sie trifft nicht automatisch auch auf Wirtschaftsräume außerhalb der Zentren zu. Diese müssen aus verschiedenen Gründen differenzierter betrachtet werden. Und dann gibt es ein Land, das in mehrerer Hinsicht, aber besonders in Bezug auf das Wachstum, eine Ausnahme darstellt, nämlich China (dazu später mehr).
Das Aufkommen der Ideologie des Neoliberalismus kann als Versuch gesehen werden, im Sinne des Kapitals Maßnahmen gegen die Wachstumsschwäche zu begründen und durchzusetzen. Das zentrale Versprechen des Neoliberalismus war, die kapitalistischen Wachstumskräfte wieder zu entfesseln. Propagiert wurden Privatisierungen und Deregulierungen und ganz allgemein ein „schlanker Staat“. Die Gewinne sollten gesteigert, die Investitionen angeregt und damit wieder höhere Wachstumsraten erreicht werden. Eine kräftig wachsende Wirtschaft würde letztlich größeren Wohlstand und Vorteile für alle bringen, so die Verheißungen der Ideologie.
Der Neoliberalismus konnte in der praktischen Politik und in den Köpfen Vieler erheblichen Einfluss gewinnen. Dieser Einfluss hält noch an, er ist noch keineswegs überwunden. Viele von den Neoliberalen ausgegebenen Ziele wurden auch mehr oder weniger erreicht (Privatisierungen, Sozialabbau, Verbilligung der Arbeitskraft durch Ausdehnung des Niedriglohnsektor und der Zunahme von prekären Arbeitsbedingungen, etc.). Dadurch wurde generell die Position des Kapitals gestärkt, es fand eine Umverteilung von Unten nach Oben statt.
Bei seinem eigentlichen Ziel, nämlich der Entfesselung der Wachstumskräfte, ist der Neoliberalismus aber gescheitert. Das lässt sich nach Jahrzehnten neoliberal geprägter Politik feststellen. Das starke Wirtschaftswachstum, das die ökonomische Basis für die Lösung aller sonstigen Probleme hätte sein sollen, hat sich nicht eingestellt.
Entfesselt wurden aber, durch Deregulierungen, die Finanzmärkte. Dorthin flossen große Mengen des nach Anlage suchenden Kapitals. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Krisen der letzten Jahrzehnte auf das engste mit der Finanzwelt verbunden waren. Das trifft vor allem für die Finanzkrise ab 2008 zu und für alle direkt mit ihr verbundenen Folgekrisen (Euro-Krise, Spanien-, Irland-, Griechenlandkrise).
Die Finanzkrise erreichte durchaus die Qualität einer Systemkrise. Nach dem Bankrott des Bankhauses Lehman Brothers lag ein Zusammenbruch des internationalen Finanzsystem im Bereich des Möglichen, das europäische Währungssystems war in Gefahr. Die Staaten und die Notenbanken mussten massiv intervenieren. Die Aktivitäten der Staaten als Krisenmanager waren selbstverständlich auch im Sinne des Kapitals, es war in der Regel der größte Nutznießer der Rettungsaktionen. Allerdings zeigten die staatlichen Eingriffe auch Resultate, die den ursprünglichen Zielen der Neoliberalen widersprechen.
Sichtbar wird das etwa bei der zunehmenden öffentlichen Verschuldung. Diese wird zwar in den Medien heftig beklagt, es wird ständig mehr Sparsamkeit gefordert und immer wieder werden Regeln aufgestellt, die die Verschuldung zügeln sollen (etwa die Maastrichtkriterien für die EU oder die Schuldenbremse in Deutschland). Aber letztlich kann die Begrenzung der Verschuldung nicht umgesetzt werden. Immer neue Krisen (Finanzkrise, Pandemie, Krieg) erfordern neue Rettungsaktionen. So steigt in praktisch allen Ländern der Verschuldungsgrad immer weiter an.
Ein ganz ähnlicher Effekt zeigt sich bei der ökonomischen Rolle der Staaten. Ziel war es, staatliche Interventionen klein zu halten. Die diversen Staatseingriffe, die während der Krisen erfolgten und auch aus Sicht der Neoliberalen erfolgen mussten, um weitere Krisenzuspitzungen zu verhindern, liefen dem Ziel eines schlanken Staates aber entgegen. Das Resultat war vielfach keine Schwächung, sondern eher eine Stärkung der ökonomischen Rolle der Staaten. Deren Anteil am wirtschaftlichen Geschehen, z.B. gemessen am Staatsanteil des BIP, ist keineswegs radikal geschrumpft.
Die Dominanz des Neoliberalismus konnte also nicht verhindern, dass in der Realität ein erheblicher Teil der propagierten Ziele verfehlt wurde. Ihre Verwirklichung musste immer wieder in die Zukunft verschoben werden, weil akute Erfordernisse sich aufdrängten und eine neue Priorisierung erzwangen.
Nach dem Abflauen der jeweiligen akuten Krisenerscheinungen folgte zwar immer wieder eine gewisse Normalisierung mit ruhigerem Wirtschaftsverlauf (etwa die Jahre 2011 bis 2019 nach der Finanzkrise). Aber es ist nicht gelungen, die tieferen Ursachen der Krisen zu beseitigen. Die latente Überakkumulation gibt es nach wie vor, große Massen an Kapital suchen weiterhin im Finanzsystem nach einer Rendite. Es gelang nur, die schlimmsten Auswirkungen (etwa den Zusammenbruch des Finanzsystems) zu vermeiden. Die ökonomische Lage bleibt aber labil, die Krisenursachen schwelen weiter und können sich jederzeit wieder zu akuten Krisen verdichten.
Außenwirtschaftlich besteht das Programm des Neoliberalismus in einem umfassenden Freihandel. Angestrebt wird nicht nur der zollfreie und ungehinderte Austausch beim internationalen Handelsverkehr von Waren. Auch das Kapital soll ungehindert zirkulieren können, genauso wie angestrebt wird, jegliche Art von Dienstleistungen in diesen „Freihandel“ einzubeziehen.
Die neoliberale Zeit war geprägt von einer starken Zunahme der Globalisierung. Immer größere Teile der Produktion wurden von den Zentren in Länder mit niedrigen Lohnkosten verlagert, die Lieferketten wurden immer länger und komplexer.
Der Schub bei der Globalisierung wurde zusätzlich noch durch einige andere Bedingungen ermöglicht. Immer mehr Länder erreichten einen Entwicklungsstand, bei dem einerseits Mindestanforderungen bezüglich Qualifikation der Arbeitskräfte und Ausbau der Infrastruktur erfüllt waren, andererseits die Löhne noch ausreichend niedrig blieben. Dazu kamen gesunkene Transportkosten und die modernen Kommunikationssysteme, die eine weltweite Steuerung der Lieferketten ermöglichen.
China als Ausnahme in der Weltwirtschaft
Wie bereits erwähnt, muss China als Ausnahme in der Weltwirtschaft angesehen werden. China hat seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg erlebt. Das ist allgemein bekannt und muss hier nicht im Detail ausgeführt werden.
Wegen der Größe Chinas und der Rasanz der dortigen Entwicklung schlägt der Aufstieg Chinas bis in die globalen Statistiken durch. Wenn die ausgewiesenen Wachstumsraten für das weltweite BIP in den vergangenen Jahrzehnten noch beträchtlich waren, liegt das nicht unwesentlich an China. Denn dort wurde ein erheblicher Teil des jährlichen Zuwachses erwirtschaftet. Ähnliches gilt auch für andere Statistiken, etwa über die Verringerung der absoluten Armut. Ohne den Anteil Chinas wären die ausgewiesenen Erfolge sehr viel bescheidener.
Nicht nur für die Statistiken war China ein wesentlicher, ja dominanter Faktor. Der industrielle Aufbau in China ließ für die übrige Welt die Exportmöglichkeiten nach China stark ansteigen. In Deutschland profitieren vor allem der Maschinenbau und die Investitionsgüterindustrie.In anderen Ländern (Südamerika, Afrika) sind es vor allem Rohstoffe, seien es mineralische oder landwirtschaftliche, die nach China exportiert werden. Der Verlauf der chinesischen Konjunktur hatte schon mehrmals durchschlagenden Einfluss auf die Weltmarktpreise einzelner Rohstoffe. Das belegt die Bedeutung, die Chinas inzwischen erlangt hat.
Dem Export nach China steht der Import aus China gegenüber. Aus China wird eine Vielzahl von (meistens preisgünstigen) Waren importiert, sowohl Endprodukte als auch eine vermutlich noch größere Zahl von Vor- und Zwischenprodukten, die in den Importländern weiterverarbeitet werden. Chinesische Produzenten sind ganz wesentlich in das Geflecht der weltweiten Lieferketten integriert. Sehr viele Waren auf den Weltmärkten basieren auf einem mehr oder weniger großen Anteil aus chinesischer Produktion.
Die günstige Produktion in China und in den anderen in die Globalisierung einbezogenen Ländern hatte auch einen erheblichen Anteil an der bis vor kurzem zu beobachtenden Preisstabilität in den meisten entwickelten Ländern. Es wurden nicht nur Waren importiert, sondern auch stabile Preise.
Selbstverständlich bedeutet der Aufstieg Chinas gleichzeitig auch stärkere Konkurrenz für Produzenten außerhalb Chinas. Oft war das nicht einfach eine zusätzliche Konkurrenz, viele betroffene Produzenten konnten dem Druck nicht standhalten. Dabei sind erhebliche Unterschiede je nach Branchen, Ländern und Regionen zu beobachten. Das Spektrum reicht von gelungenen Anpassungen an die neue Lage, bis hin zur massiven Verdrängung von wichtigen Industriezweigen mit Betriebsschließungen, Arbeitslosigkeit, wirtschaftlichem Abstieg etc.. Die Entwicklung in China erzeugte ökonomische Gewinner und Verlierer außerhalb Chinas, wobei Gewinner und Verlierer sehr ungleich verteilt sind. Deutschland gehört insgesamt eher zu den Gewinnern.
Die wahrscheinlich größte weltwirtschaftliche Bedeutung Chinas lag in der Aufnahme von nach Anlage suchendem Kapital. Große Mengen an ausländischem Kapital strömten nach China und fanden dort eine Verwertungsmöglichkeit. Es trug zum dortigen Aufbau der Industrie bei und konnte sich dabei profitabel verwerten. Anfangs kam das Kapital schwerpunktmäßig aus Taiwan und der chinesischen Diaspora. Bald sprangen aber auch die transnationalen Konzerne aller Länder auf den Zug auf. Nicht zuletzt auch die aus Deutschland. VW, BMW, Mercedes oder BASF sind Beispiele für deutsche Firmen, die erheblich nach China expandiert und dort große Produktionsstätten aufgebaut haben. Die Liste ließe sich leicht verlängern. Inzwischen ist es auch für Betriebe, die deutlich kleiner sind als die genannten Konzerne und auch für Mittelständler nicht mehr ungewöhnlich, in China mit einer eigenen Produktion vertreten zu sein.
Bis zu einem gewissen Grad konnte der Aufschwung in China einen Ausweg für die Schwäche der Kapitalakkumulation in den kapitalistischen Zentren bieten. Damit wurde objektiv ein erheblicher Beitrag zur Stabilisierung des Kapitalismus außerhalb Chinas geleistet. Dieser Beitrag kam insbesondere den entwickelten alten Industrieländern mit ihrer Wachstumsschwäche zugute. Dort sitzen auch die meisten transnationalen Konzerne, die in großem Stil in China investieren konnten.
China ist aber auch in einer zweiten Hinsicht eine Ausnahme. Es handelt sich beim chinesischen Aufstieg nicht nur um ein kräftiges Wirtschaftswachstum mit einem entsprechenden Anstieg des BIP. China hat eine gelungene nachholende Entwicklung vollzogen. Am Anfang standen einfache Produktionen (z.B. Textilien) im Vordergrund. Darauf folgten schrittweise technisch immer anspruchsvollere. Inzwischen ist China auch in Bereichen der Hochtechnologie erfolgreich. Es fängt an, sich mit den bisherigen Zentren des Kapitalismus zu messen und mit ihnen, auch im Hinblick auf modernste Technologien, in Konkurrenz zu treten.
Ein technologisches Gleichziehen ist zwar noch nicht in allen Bereichen erreicht. Es ist aber damit zu rechnen, dass sich der Aufholprozess grundsätzlich fortsetzen wird und die noch vorhandenen Rückstände in nicht allzu ferner Zukunft weitgehend überwunden werden können.
In dieser Beziehung unterscheidet sich China wesentlich von vielen anderen Ländern und Gebieten, die ebenfalls stark in die globalisierten Lieferketten einbezogen sind. Denn so unterschiedlich die konkreten Verhältnisse in diesen anderen Standorten im einzelnen auch sein mögen, eine Gemeinsamkeit haben sie: Sie verharren weitgehend im Stadium eines finanziell und technologisch von den Zentren abhängigen Kapitalismus. Von Entwicklungsprozessen hin zum Aufbau eigener, unabhängiger Produzenten in der Hochtechnologie wird jedenfalls nicht berichtet, weder von den Betrieben in Mexiko nahe der Grenze zu den USA, den sogenannten Maquiladoras, noch von den Textilbetrieben in Bangladesh oder Kambodscha, aber auch nicht aus Osteuropa (um nur einige Beispiele zu nennen).
Um es zusammenzufassen: Der Aufstieg Chinas führte zur Herausbildung einer weiteren Weltmacht, ökonomisch und politisch. Er hatte auch erhebliche Auswirkungen für die ökonomischen Entwicklungen außerhalb Chinas, für die gesamte kapitalistische Weltwirtschaft. Wie alle starken Veränderungen war das durchaus ein widersprüchlicher Prozess, der aber auch zur Belebung der Kapitalakkumulation beitrug und bedeutende neue Exportmöglichkeiten eröffnete. Etwas vereinfachend kann man feststellen: Ohne China wären die letzten Jahrzehnte für das Kapital aus den alten kapitalistischen Zentren wirtschaftlich schlechter verlaufen, die Tendenz zur Wachstumsschwäche in diesen Ökonomien wäre deutlicher sichtbar geworden.
Veränderungen und Tendenzen, bereits vor Beginn des Krieges
Der Beginn des Ukraine-Krieges bedeutet einen starken Einschnitt. Aber bereits vorher und unabhängig davon bahnten sich wichtige ökonomische Veränderungen an. Insbesondere sind drei Tendenzen zu nennen, die ein Ende gefunden haben, nachdem sie vorher etliche Jahre für das wirtschaftliche Geschehen charakteristisch waren.
Da ist einmal die Globalisierung zu nennen. Deren Potenzial scheint vorerst weitgehend ausgeschöpft zu sein. Das weitere Vorantreiben der Globalisierung generiert anscheinend für viele Akteure keine zusätzlichen Vorteile mehr. Der Nutzen von Maßnahmen, die typischerweise mit der Globalisierung verbunden sind, wie just-in-time-Produktion mit minimierter Lagerhaltung und die ständige Ausdehnung der Lieferketten, sowohl geographisch als auch bezüglich ihrer Komplexität, ist weitgehend ausgereizt. Die Anfälligkeit für Störungen wurde dagegen gleichzeitig immer größer. Bereits relativ kleine Ursachen können zu erheblichen und kaum mehr überschaubaren Folgewirkungen führen.
Diese Anfälligkeit ist während der Pandemie, ausgelöst durch Lockdowns mit Unterbrüchen in Produktion und Transport, mehrfach demonstriert worden. Es ist davon auszugehen, dass spätestens mit dem Beginn der Pandemie, eventuell auch schon früher, die Globalisierungswelle vorerst einmal ausgelaufen ist. (Neue Schübe in der Zukunft sind natürlich nicht ausgeschlossen.) Aber das Auslaufen der Welle bedeutet nicht die Rückgängigmachung der Globalisierung. Einzelne Produktionen können selbstverständlich rückverlagert werden, insbesondere wenn den betroffenen Produkten eine strategische Bedeutung zugesprochen wird. In der Mehrzahl der Fälle dürfte aber die wirtschaftliche Logik nach wie vor für den Erhalt der ja bereits erfolgreich durchgeführten Globalisierung sprechen. Eine Rückabwicklung der Globalisierung im großen Maßstab ist zuerst einmal nicht zu erwarten.
Die zweite Änderung betrifft die relative Preisstabilität. Denn mit der Globalisierung ist auch deren die Inflation dämpfende Wirkung zu einem Ende gekommen. Bereits 2021 zeigten sich Ansätze für ein stärkeres Ansteigen der Verbraucherpreise.(siehe dazu „Die Rückkehr der Inflation“ in der ARSTI Nr. 218).
Als drittes ging die Phase mit den niedrigen Zinsen zu Ende. Die lange Periode mit sehr niedrigen Zinsen wurde im Zusammenhang mit der Finanzkrise eingeleitet. Bis zum deutlichen Anstieg der Preise schreckten die Notenbanken davor zurück, die expansive Geldpolitik wieder zurückzunehmen. Vermutlich, weil sie die Lage als noch nicht stabil genug einschätzten.
Der Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen
Der Ukraine-Krieg hat in erster Linie politische Ursachen, genauso wie die westlichen Maßnahmen gegen Russland politisch motiviert sind. Dabei gilt festzuhalten: Russland hat den Krieg ausgelöst, die wirtschaftlichen Folgen sind aber überwiegend auf die Entscheidungen der westlichen Regierungen zurückzuführen. Denn die westlichen Gegenmaßnahmen bestehen, neben den Waffenlieferungen und sonstigen Hilfen für die Ukraine, im wesentlichen aus Sanktionen, mit denen wirtschaftlicher Druck auf Russland ausgeübt werden soll. (Siehe auch „Die Sanktionen gegen Russland ...“ ARSTI Nr. 216)
Für viele westlichen Firmen, es ist von ungefähr 1000 die Rede, bedeuten die Sanktionen den Verlust des russischen Marktes. Auch einige Firmen aus Branchen und Geschäftsbereichen, die nicht direkt mit Sanktionen belegt sind, haben sich angesichts des veränderten Umfelds aus dem Russlandgeschäft zurückgezogen. Sanktionen gegen Russland gibt es bekanntlich schon seit 2014. Seitdem ist eine rückläufige Tendenz im Geschäftsumfang zu beobachten. Aber jetzt gehen alle Maßnahmen viel weiter und haben radikalere Wirkungen. Sicher, der russische Markt ist für die betroffenen Firmen im allgemeinen nicht allzu groß, aber er ist auch nicht einfach zu vernachlässigen. In Deutschland spielte das Geschäft mit Russland eine viel größere Rolle als in vielen anderen Ländern. Deutschland ist deshalb auch stärker vom Ende dieses Geschäfts betroffen als andere, insbesondere viel stärker als die USA.
Durch den Ausschluss von russischen Produzenten gab und gibt es bei eine Reihe von Waren Lieferprobleme, kombiniert mit heftigen Schwankungen der Weltmarktpreise. Betroffen waren z.B. Düngemittel, Getreide, Stahl, Holz und verschiedene andere Rohstoffe wie etwa Nickel.
Von viel größerer Tragweite sind die Veränderungen im Energiesektor. Erdöl und Kohle sollen gemäß den Sanktionen nicht mehr aus Russland importiert werden (wobei es komplizierte Übergangsregeln gibt). Gas ist formal nicht von den westlichen Sanktionen betroffen, real haben sich aber die aus Russland gelieferten Mengen stark reduziert. So sind die direkten Lieferungen nach Deutschland vollständig zum Erliegen gekommen. Erst wegen technischer Probleme, so zumindest die offizielle Begründung aus Russland, und dann aufgrund von Sabotage an den Gaspipelines in der Ostsee. Wer immer für diese Explosionen verantwortlich war, vorerst kann durch drei von vier vorhandenen Pipeline-Strängen kein Gas mehr transportiert werden. Der vierte Strang, der zu Nord Stream 2 gehört, wurde zwar nicht beschädigt, ist aber nicht in Betrieb, weil das für die Betriebsgenehmigung notwendige Zertifizierungsverfahren von Deutschland gestoppt wurde.
Die stark verminderten Gaslieferungen sind das eigentliche Problem. Denn bei Erdöl und bei Kohle ist die Beschaffung von Ersatz einfacher und auch viel kurzfristiger realisierbar als bei Gas aus Pipelines. Die direkte Folge des Ausfalls der russischen Lieferungen besteht im sprunghaften Anstieg des Gaspreises, der Wirtschaft und private Haushalte erheblich belastet. Die hohen Gaspreise schlagen auch auf die Strompreise durch.
Dabei geht es nicht nur um die höheren Rechnungen für Gas und Strom, die die Verbraucher bezahlen müssen. Denn Energie wird überall in der Produktion gebraucht und steckt in praktisch jedem Produkt drin. Von der Erhöhung der Energiepreise geht deshalb ein gewaltiger Inflationsschub aus. Deutschland hatte mit den russischen Gaslieferungen eine relativ preisgünstige Energiequelle. Die Strategie war, Gas im Zuge der Umstellung auf nicht fossile Energie als sogenannte Brückentechnologie zu nutzen. Gas sollte als letzte fossile Energiequelle aufgegeben werden. Denn Erdgas setzt beim Verbrennen weniger CO2 frei als Öl oder gar Kohle. Außerdem ist es flexibel für viele Zwecke (Industrie, Heizen von Wohnungen, Kraftwerke) einsetzbar. Diese Strategie ist jetzt weitgehend hinfällig. Durch den vermehrten Einsatz von Kohle bzw. Öl statt Gas kam es wieder zu Rückschritten im Vergleich mit der bereits erreichten Position. Flüssiggas (Liquid Natural Gas, LNG), das mittelfristig wahrscheinlich die wichtigste Alternative sein wird, ist wesentlich teurer, erfordert Milliardeninvestitionen für die Terminals und ist auch ökologisch (noch) problematischer als Pipeline-Erdgas, weil die für den Transport notwendige Verflüssigung viel Energie frisst.
Die Preise für Gas auf den Spotmärkten sind seit dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine mehrfach sprunghaft angestiegen. Den Höchststand erreichten sie etwa Ende August/ Anfang September 2022, als insbesondere die Bundesnetzagentur im großen Stil Gas einkaufte, um die Speicher für den Winter aufzufüllen. Anscheinend wurde dabei jeder Preis bezahlt (bis über dem 17 fachen des Preises vor der Krise). Seitdem sind die Preise an den Spotmärkten wieder deutlich gefallen, blieben allerdings, stark schwankend, auf einem Niveau, das noch ungefähr doppelt bis viermal so hoch ist wie vor der Krise. Als Preis vor der Krise werden ca. 20 € pro Megawattstunde angenommen, das entspricht etwa dem langjährigen Mittel der Preise von 2012 bis 2020. Nach übereinstimmender Einschätzung kann auch der Winter 2023/24 nochmals kritisch in Bezug auf die Beschaffung genügend großer Gasmengen werden, mit entsprechend wieder stark ansteigenden Preisen. Es ist sehr schwierig abzuschätzen, auf welchem Niveau sich die Preise mittelfristig einpendeln werden, zu vieles ist noch unklar und offen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Preise aber auch langfristig deutlich über den Vorkrisenzeiten liegen. Die privaten Haushalte und die Wirtschaft müssen sich auf auf weit höhere Gaspreise und damit auch Strom- und ganz allgemein Energiepreise einstellen. Es handelt sich dabei um beträchtliche Summen, die bezahlt werden müssen. Das ist ein Nachteil gegenüber anderen Volkswirtschaften und vermindert die Konkurrenzfähigkeit. Viele sehen schon den Industriestandort Deutschland in Gefahr, ganz besonders für alle energieintensiven Branchen. Die Angst vor Deindustrialisierung geht um. Während andere europäische Länder auch vom Preisanstieg betroffen sind, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß (Gasproduzenten wie Norwegen profitieren sogar), ist die US-Wirtschaft kaum betroffen, im Gegenteil, sie profitiert durch vermehrten Verkauf ihres Fracking-Gases von der Situation. Eine mögliche Folge des Ukraine-Kriegs ist deshalb neben der Stärkung der politischen Position der USA auch eine Stärkung ihrer wirtschaftlichen Position.
Nicht vergessen darf man die Kosten, die durch die politischen Entscheidungen der Regierungen entstehen: die Kosten für die Aufrüstung der Bundeswehr und die vielfältigen Kosten für die Unterstützung der Ukraine. Die fälligen Summen lassen sich zur Zeit noch nicht wirklich abschätzen. Die 100 Milliarden als „Sondervermögen“ für die Bundeswehr sind erklärtermaßen nur der Anfang. Zukünftig sollen die Militärausgaben dauerhaft das von den NATO-Ländern beschlossene Ziel von mindestens 2% des BIP erreichen. Welche Kosten letztendlich mit der Unterstützung der Ukraine durch Waffenlieferungen, Hilfen für den dortigen Staatshaushalt, den Aufwand für Flüchtende usw. und irgendwann auch für den Wiederaufbau anfallen werden, ist noch völlig offen. Auch wenn viele dieser Unterstützungszahlungen formal als Kredite an die Ukraine verbucht werden, ist davon auszugehen, dass eine reguläre und reibungslose Rückzahlung für alle diese Kredite kaum möglich sein wird.
Zieht man aus alldem Bilanz, kommt man nicht um die Feststellung herum: die Lage hat sich für Deutschland erheblich eingetrübt. Für 2023 wurde zuerst eine milde Rezension prognostiziert (Rückgang des BIP je nach Prognose 0,4 bis 0,6 %). Inzwischen sind die regierungsamtlichen Erwartungen wieder etwas gestiegen. Was wirklich kommt, ist abzuwarten. Eine optimistische Sicht zu verbreiten, gehört zum Job von Politikern und staatsnahen Experten.
Das zweite große Problem ist die Inflation. Die Preise steigen auf breiter Front, nicht nur die Energiepreise, wenn auch die ganz besonders. Große Preistreiber sind z.B.auch Lebensmittel. Erhebliche Reallohnverluste sind zu erwarten.
Auch das Ende der niedrigen Zinsen ist nicht unproblematisch. Zwar sind dann wieder Zinsen auf Sparguthaben zu erwarten, aber bei den jetzigen Inflationsraten werden die gezahlten Zinsen Kaufkraftverluste beim Ersparten nicht verhindern. Höhere Zinsen verteuern Kredite und damit tendenziell auch alle Investitionen, sei es für den Wohnungsbau, den notwendigen Umbau der Energiewirtschaft, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder Verbesserungen der (oft marode gewordenen) Infrastruktur. Es besteht die große Gefahr, dass unter den neuen Bedingungen die dringend anstehenden Aufgaben nicht ausreichend umgesetzt werden. Dabei hinkt schon jetzt die Realisierung (z.B. bei den Maßnahmen gegen dem Klimawandel) deutlich hinter den notwendigen Erfordernissen her.
Krieg und Sanktionen haben die wirtschaftliche Lage verschlechtert, insbesondere weil die jetzt teuer gewordene Energie in vielen Branchen für die Produktion grundlegend ist. Im Energiesektor steht auch die Transformation an weg von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Quellen. Für diese Transformation gab es schon immer Anforderungen, die mit dem heutigen Stand der Technik nicht so ohne weiteres vereinbar sind, nämlich die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis (fast) gegen Null bei gleichzeitig günstigen und sozial verträglichen Preisen für Industrie, Gewerbe und private Haushalte. Die Verteuerung der Energie verschärft diesen Zielkonflikt zusätzlich. Es wird diesbezüglich noch viele Konflikte geben.
Sowohl bei der Pandemie als auch bei den Kriegsfolgen versuchten die jeweiligen Regierungen (die CDU/SPD-Koalition genauso wie jetzt die Ampel) durch relativ umfangreiche staatliche Programme gegenzusteuern. Dazu wurde die Schuldenbremse ausgesetzt und eine erhebliche Neuverschuldung in Kauf genommen. Dieses Ausgabeverhalten dürfte aber nicht von Dauer sein. Sparrunden und Verteilungskämpfe sind für die Zukunft vorprogrammiert. In manchen Medien und von manchen Branchenvertretern wird ein düsteres Bild gezeichnet. Es ist von drohenden Insolvenzen und der Abwanderung ganzer Wirtschaftszweige die Rede. Ohne die Probleme klein zu reden, muss man doch darauf hinweisen, dass die Klagen vieler Verbände und Interessengruppen auch taktisch begründet sind. Es gilt, die eigenen Interessen in Stellung zu bringen bei der Jagd nach Subventionen, Steuervergünstigungen oder ganz allgemein zur Beeinflussung des staatlichen Handelns zu eigenem Gunsten.
Der Ukraine-Krieg hat bei den sogenannten etablierten Parteien (CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP, die fast ausschließlich die Regierungen im Bund und in den Ländern stellen) eine Verschiebung der Prioritäten ausgelöst. Wegen der neuen Prioritäten wurden aber auch, nur wenige Monate nach der Regierungsbildung im Bund, die bei den Koalitionsverhandlungen ausgehandelten Kompromisse in wichtigen Teilen schon wieder Makulatur. Zumindest für die Bereiche Bundeswehr und Rüstung, sowie bei Energie und als Folge auch bei den Finanzen können sie nicht mehr wie ursprünglich vereinbart umgesetzt werden. Neue Kompromisse müssen gefunden werden. Dieser Prozess ist noch keineswegs abgeschlossen und könnte noch Sprengkraft entwickeln.
Es dürfte jedem klar sein, beim Ukraine-Krieg geht es auch und vor allem um die geopolitischen Konflikte und Rivalitäten zwischen dem „Westen“ mit der Führungsmacht USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen. Ohne Geopolitik ist der Konflikt in der Ukraine nicht zu verstehen.
Gleichzeitig zeichnet sich ein weiterer geopolitischer Konflikt von noch viel größerer Tragweite ab, nämlich das Verhältnis zu China. Die bedeutende ökonomische Rolle Chinas wurde oben schon umrissen. Offensichtlich ist der Aufstieg Chinas so weit fortgeschritten, dass aus Sicht der USA eine Neubewertung der Beziehungen ansteht, möglicherweise mit einer sehr grundsätzlichen Entscheidung über deren zukünftigen Charakter.
Die Konfrontation USA-China, die drohende Krise am Horizont
Der wirtschaftliche Aufbau in China hat für das westliche Kapital viele Möglichkeiten geschaffen, ebenfalls von dieser Entwicklung zu profitieren. Diese Möglichkeiten wurden auch genutzt, so dass jetzt für Firmen aus vielen Ländern das Geschäft mit und in China eine erhebliche Bedeutung hat. Das ist bei Deutschland so, bei anderen europäischen Ländern, bei Japan und Südkorea, von Taiwan, das natürlich in einer Sondersituation ist, ganz zu schweigen. Aber auch die USA pflegen einen großen Austausch mit China. Bekanntlich lässt Apple den größten Teil seiner Produkte in China produzieren, General Motors, Ford und Tesla produzieren auch dort, um nur einige Beispiele zu nennen. Trotz der Strafzölle, die unter Trump eingeführt und von Biden nicht aufgehoben wurden, ist der Import aus China keineswegs zurückgegangen, sondern in den letzten Jahren noch etwas angestiegen. Bedingt durch die jahrelangen Exportüberschüsse gegenüber den USA hat China große Devisenreserven in Dollar angehäuft und hält sehr viele US-amerikanische Staatsanleihen. Schon seit längerem ist China damit der größte Gläubiger der USA und trägt so auch erheblich zur Finanzierung des US-Budgetdefizits bei.
Die erfolgreiche Entwicklung in China wird aber von den westlichen Ländern auch als Problem gesehen. Denn China befindet sich nicht mehr in der Position eines Landes mit einem Kapitalismus, der von den traditionellen Zentren abhängt. Wie oben beschrieben, ist es inzwischen auch auf dem Gebiet der Hochtechnologie erfolgreich und in der Lage, eigene Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung in Produkte umzusetzen. Allein schon wegen seiner Größe ist mit China ein ökonomisches Schwergewicht und damit auch ein bedeutender Machtblock entstanden. Außerdem musste der Westen realisieren, dass mit dem bestimmenden Einfluss der chinesischen kommunistischen Partei ein Führungszentrum vorhanden ist, das eine eigenständige Politik betreibt und sich keiner westlichen oder, präziser, keiner US-amerikanischen Vormundschaft unterwirft.
Die Situation ist also widersprüchlich. Einerseits kann man durchaus ein Interesse des westlichen Kapitals und der kapitalistischen Länder an guten Geschäften und deshalb auch an einer einigermaßen gedeihlichen Zusammenarbeit mit China unterstellen. Das gilt prinzipiell auch für die USA, auch beim US-Kapital besteht dieses Interesse.
Andererseits nimmt die Rivalität zu und es stellt sich die Frage der Systemkonkurrenz. Anscheinend gab es im „Westen“ lange die Hoffnung, China werde sich nach den Reformen von Deng Xiaoping langfristig den Verhältnissen im „Westen“ annähern, erst ökonomisch und nach und nach auch gesellschaftlich und politisch. Seit Xi Jinping die Führung übernommen hat, sind diese Hoffnungen bei den westlichen Regierungen und Meinungsmachern offensichtlich weitgehend verschwunden.
Wie sich China gesellschaftlich weiter entwickeln wird, ist selbstverständlich von entscheidender Bedeutung. Für Linke, Marxisten und Kommunisten steht dabei die Frage im Mittelpunkt, ob China ein Voranschreiten in Richtung Sozialismus realisieren kann oder eben nicht.
Für die Einstufung als Systemkonkurrenten durch die USA und dem „Westen“ ist aber keineswegs allein die Frage „ Sozialismus ja oder nein“ und die tatsächliche gesellschaftliche Entwicklung in China entscheidend. Die westlichen Mächte haben da durchaus ihre eigenen Kriterien und Gründe (die auch nicht ausschließlich rational sein müssen), um zu entscheiden, wen sie als System- bzw. Hauptkonkurrenten betrachten und für wie gefährlich sie diese Konkurrenz halten.
Außerdem ist eine Auseinandersetzungen um Hegemonie auch ohne direkte Systemkonkurrenz denkbar. Nicht zufällig sehen sich vor allem die USA als die westliche, kapitalistische Führungs- oder Hegemonialmacht durch China herausgefordert. Spätestens seit der Präsidentschaft von Barak Obama wird China als der (zukünftigen) Rivale identifiziert, der in der Lage sein könnte, die eigene hegemoniale Position in Frage zu stellen. Diese Einschätzung ist eines der wenigen Themen, bei dem es eine weitgehende Übereinstimmung zwischen Demokraten und Republikanern gibt. In den Think Tanks der USA und ähnlichen Kreisen läuft eine intensive Debatte über mögliche Strategien mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Gleichzeitig wird die Rivalität größer und immer offensichtlicher. Inzwischen gibt es eine Reihe von US-amerikanischen Maßnahmen, die die weitere Entwicklung Chinas in Richtung Hochtechnologie behindern sollen. Neben den Zöllen aus der Trump-Zeit und dem Ausschluss der Firmen Huawei und ZTE beim Aufbau des 5G Netzes kam es jüngst zu weiteren Einschränkungen. Der Verkauf von neuen, bisher in den USA noch nicht zugelassenen Geräten der Firmen Huawei und ZTE wurde generell untersagt. Exporte von Hochtechnologie, insbesondere der Export der modernsten elektronischen Chips und Geräte zu deren Herstellung, wurden als genehmigungspflichtig eingestuft. Sie können damit jederzeit von der Regierung unterbunden werden. Anscheinend kam es im Januar 2023 auch zu (noch nicht im Detail veröffentlichten) Vereinbarungen mit Japan und den Niederlanden über die Einschränkung des Exports von Geräten zur Chipproduktion nach China. In den Niederlanden hat ASLM, der weltweit führende Hersteller von Fertigungsanlagen für Hochleistungschips, seinen Sitz. Gleichzeitig mit den Exportbeschränkungen wurde das Ziel einer Rückverlagerung der Chipproduktion in die USA proklamiert. Dazu wurden milliardenschwere Förderprogramme aufgelegt.
Für die Verbündeten der USA und damit auch für EU und Deutschland ergibt sich aus dieser Situation ein Dilemma. Einerseits wollen sie möglichst viel vom profitablen China-Geschäft mitnehmen, andererseits müssen sie auf eine härtere Auseinandersetzung USA-China in der Zukunft mit all ihren Implikationen vorbereitet sein. Der weltwirtschaftlichen Bedeutung Chinas entsprechend geht es dabei um sehr viel Geld, es steht sehr viel auf dem Spiel.
Dies gilt besonders für Deutschland. Schließlich beruht der Erfolg der deutschen Variante des Kapitalismus zu einem ganz erheblichen Teil auf den für seine Produkte offenen Weltmärkten. Vielfach handelt es sich um anspruchsvolle, hochentwickelte Produkte mit einem großen Wertschöpfungsanteil, hergestellt von einer entsprechend spezialisierten Industrie. So konnte Deutschland Exportweltmeister werden. Die internationale Konkurrenzfähigkeit wurde unter anderem von einer günstigen Energieversorgung, basierend auf den russischen Gaslieferungen, unterstützt. Dieser Aspekt ist bereits weggefallen. Je mehr weitere Einschränkungen dazu kommen, desto kritischer wird die Lage.
Auch aus anderen Gründen wird die Konkurrenz härter und der Spielraum kleiner. Man denke aktuell nur an das sogenannte „Inflation Reduction Act“ der USA. Dieses Gesetz soll unter anderem die Klimatransformation fördern, gewährt aber die erheblichen Subventionen und Steuervergünstigungen im vollen Umfang nur, wenn dafür Produkte aus nordamerikanischer Produktion (USA, Kanada, Mexiko) eingesetzt werden. Das Gesetz trägt also protektionistische Züge.
Es stellt sich die Frage, ob im Rahmen sich weiter zuspitzender Beziehungen zwischen den USA und China das europäische bzw. deutsche Kapital seine speziellen Interessen auch gegen die Führungsmacht zur Geltung bringen will und kann. Ist es denkbar, dass sich die EU, oder gar Deutschland allein, von den USA emanzipieren und einen eigenständigen Kurs gegenüber China einschlagen?
Bei der Beurteilung dieser Frage müssen die engen Beziehungen der Wirtschaftsräume (Deutschland, Europa, USA) berücksichtigt werden und vor allem die vielfältigen und gegenseitigen Verflechtungen, die auf der Kapitalseite existieren. Das heißt, US-Kapital investiert in Deutschland/Europa und deutsches/europäisches Kapital in den USA. Diese Fakten machen eine Abkoppelung nicht gerade wahrscheinlich. Die jüngsten Reaktionen beim Ukraine-Krieg mit dem schnellen und völligen Einschwenken auf die Linie der USA sprechen ebenfalls nicht dafür. Allerdings sind die ökonomischen Dimensionen bei China sehr viel größer und essentieller als im Fall Russland. Sollte eine solche Entscheidung anstehen, gäbe es vermutlich in vielen Ländern erhebliche interne Differenzen mit der Herausbildung von Pro- bzw. Kontra-Lagern. Innerhalb der EU wäre eventuell auch mit gegensätzlichen Positionierungen von einzelnen Mitgliedsländern zu rechnen, was die EU als Ganzes handlungsunfähig machen würde.
Ein Alleingang Deutschlands kann wohl ausgeschlossen werden. Ohne enge Kooperation mit anderen Ländern (möglichst auch über den Kreis der EU hinaus) ist eine größere Abweichung vom Kurs der USA sehr unwahrscheinlich. Eigentlich ist eine Abkoppelung nur dann denkbar, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Einmal, wenn die USA ihrerseits immer weniger Rücksicht auf die Interessen ihrer europäischen und sonstigen Verbündeten nehmen (wie das unter Trump schon ansatzweise geschehen ist) und zweitens, wenn der Gegensatz USA-China nicht als Systemgegensatz gesehen wird, sondern „nur“ als Auseinandersetzung um die hegemoniale Position. (Ob das eine realistische Möglichkeit ist, sei hier dahingestellt). Ein dominierender Systemgegensatz wird die westlichen Länder zusammenschweißen, da alle diesbezüglich die gleichen Interessen haben. Wird eine Konfrontation dagegen als Ausdruck eines speziellen Interesses der USA gesehen, könnte das eine andere Lage bedeuten.
Zur Zeit lässt sich noch nicht klar beurteilen, welchen Verlauf die künftigen Beziehungen USA- China nehmen werden. Ohne Zweifel ist eine immer stärker werdende Konfrontation bis hin zu militärischen Auseinandersetzungen ein realistisches Szenario. Vermutlich ist aber noch keine diesbezügliche Entscheidung gefallen. Wahrscheinlich wollen sich die USA gegenwärtig noch eine gewisse Flexibilität mit mehreren Optionen offen halten. Aus dem erst kürzlich gestarteten Programm zur Rückholung der Chipproduktion könnte man ableiten, dass die USA für sich noch relevante Abhängigkeiten sehen. Sehr viele elektronische Chips, gerade die modernsten und leistungsfähigsten, werden fast ausschließlich auf Taiwan produziert. Eine Blockade dieser Lieferungen würde für viele Branchen und wahrscheinlich auch für Teile der Rüstungsindustrie den Stillstand bedeuten. So gesehen brauchen die USA noch einige Zeit zur Vorbereitung. Aber es soll hier nicht zu sehr spekuliert werden, man wird die weitere Entwicklung beobachten müssen.
Der Ukraine-Krieg und die westlichen Reaktionen darauf haben eine Reihe von ökonomischen Erschütterungen ausgelöst, die nicht so ohne weiteres bewältigt werden können. Deutschland ist dabei stärker als andere Länder betroffen, weil es bedeutende Wirtschaftsbeziehungen zu Russland hatte. Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine dauern an, ein Ende ist noch nicht abzusehen. Deshalb lassen sich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht abschließend beurteilen.
Richtig ist aber auch, dass sich viele der heute dominierenden ökonomischen Bedingungen, der Probleme und der anstehenden Aufgaben nicht durch den Krieg erklären lassen. Das Auslaufen der Globalisierung, die zunehmende Verschuldung, die Inflation, die notwendige Transformation des Energiesektors etc., das alles würde es auch ohne den Krieg geben. Deshalb ist die Rede von einer ökonomischen „Zeitenwende“ nur teilweise gerechtfertigt. Denn der Krieg hat die Situation vielfach und durchaus erheblich verschärft, modifiziert und kompliziert, aber er hat ihr keine neue Ausrichtung gegeben, wie es der Begriff „Wende“ beinhaltet.
Dagegen hat die drohende Konfrontation mit China das Potenzial für eine „Zeitenwende“, die dieser Bezeichnung in jeder Hinsicht gerecht würde. Eine harte Konfrontation mit umfassenden Sanktionen und eventuell auch militärischen Auseinandersetzungen würde noch viel stärkere Erschütterungen auslösen. Dies alles muss man im Zusammenhang mit den oben skizzierten Widersprüchen und der Krisenanfälligkeit des weltweiten Kapitalismus sehen. Noch sind die alten Zentren dominierend und haben anscheinend auch noch ausreichend Potential, um die Einbrüche und Veränderungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg einigermaßen zu bewältigen. Aber gleichzeitig ist die Labilität der Fundamente, auf denen die Wirtschaft und damit auch die Macht der kapitalistischen Zentren beruht, unverkennbar. Es ist zwar nicht möglich, aus dieser Einschätzung konkrete Prognosen für die weitere Entwicklung abzuleiten. Falsch wäre es aber, die Stärke des Westens und der USA für unerschütterlich zu halten.