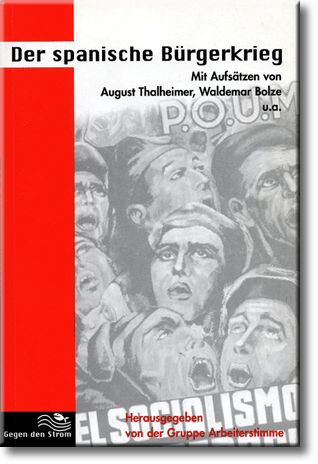Lenin schrieb 1919 zur „Revolutionären Situation“: „Für den Marxisten unterliegt es keinem Zweifel, dass eine Revolution ohne revolutionäre Situation unmöglich ist, wobei nicht jede revolutionäre Situation zur Revolution führt. (…) Wir gehen sicher nicht fehl, wenn wir folgende drei Hauptmerkmale anführen:
1. Für die herrschenden Klassen ist es unmöglich, ihre Herrschaft unverändert aufrechtzuerhalten; die eine oder andere Krise der ‚oberen Schichten‘, eine Krise der Politik der herrschenden Klasse, die einen Riss entstehen lässt, durch den sich die Unzufriedenheit und Empörung der unterdrückten Klassen Bahn bricht. Damit es zur Revolution kommt, genügt es in der Regel nicht, dass die ‚unteren Schichten‘ in der alten Weise ‚nicht leben wollen‘, es ist noch erforderlich, dass die ‚oberen Schichten‘ in der alten Weise ‚nicht leben können‘.
2. Die Not und das Elend der unterdrückten Klassen verschärfen sich über das gewöhnliche Maß hinaus.
Infolge der erwähnten Ursachen steigert sich erheblich die Aktivität der Massen, die sich in der ‚friedlichen‘ Epoche ruhig ausplündern lassen, in stürmischen Zeiten dagegen sowohl durch die ganze Krisensituation als auch durch die ‚oberen Schichten‘ selbst zu selbständigem historischem Handeln gedrängt werden. Ohne diese objektiven Veränderungen, die unabhängig sind vom Willen nicht nur einzelner Gruppen und Parteien, sondern auch einzelner Klassen, ist eine Revolution – der der Regel – unmöglich. [… Doch] nicht aus jeder revolutionären Situation [geht] eine Revolution [hervor], sondern nur aus einer solchen Situation, in der zu den oben aufgezählten objektiven Veränderungen noch eine subjektive hinzukommt, nämlich die Fähigkeit der revolutionären Klasse zu revolutionären Massenaktionen, genügend stark, um die alte Regierung zu stürzen (oder zu erschüttern), die niemals, nicht einmal in einer Krisenepoche ‚zu Fall kommt‘, wenn man sie nicht ‚zu Fall bringt‘.“1
Bereits 1902, in seinem Werk Was tun? Hatte Lenin eine Lehre von den „subjektiven Merkmalen“ der revolutionären Situation entwickelt, durch welche eine sich objektiv anbahnende Revolution beschleunigt werden könne, worunter er insbesondere den Aufbau einer proletarischen Partei, die bereit ist, die Führung zu übernehmen, verstand.2
Wer sich Anfang der 1920er Jahre als Kommunist verstand, war davon überzeugt, dass mit der russischen Oktoberrevolution 1917 die proletarische Weltrevolution begonnen hatte. Die Möglichkeit, dass die proletarische Revolution auf Russland beschränkt bleiben könnte, lag völlig außerhalb seiner Revolutionsvorstellung, weshalb sich all seine Hoffnung auf eine Ausweitung der Revolution in Europa, insbesondere auf das hoch industrialisierte Deutschland mit seiner starken und traditionsreichen Arbeiterbewegung richtete. Das gemeinsame Ziel aller Kommunisten war die radikale Umgestaltung der Verhältnisse in Deutschland – also die Fortführung der am 9. November 1918 begonnenen bürgerlich-demokratischen Revolution in die proletarische Revolution. Die Durchführung der Revolution war in diesen Jahren im Selbstverständnis der Kommunisten ein Ereignis, welches jederzeit erwartbar war – hatte der 1. Weltkrieg doch bewiesen, dass sich der Kapitalismus in seiner Endkrise befand. Für Kommunisten
standen also alle zu lösende Tagesfragen unter dem Duktus ihres Einflusses auf den eigentlich zu vollziehenden Übergang in die Revolution. Doch war ein Übergang in revolutionäre Auseinandersetzung nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik im Mai 1919 überhaupt noch eine realistische Aufgabenstellung? Die Kommunisten waren davon überzeugt. Doch die Macht lag nach dem Mai 1919, nach der Niederschlagung der Münchener Räterepublik nicht mehr auf der Straße, sondern wurde auf anderen Ebenen ausgefochten – so in den Wahlen, in den Parlamenten oder außerparlamentarisch in Streiks. Die große Chance auf eine erfolgreiche sozialistische Revolution war bereits im ersten Halbjahr 1919 vergeben, zum einen weil es den Befürwortern der bürgerlichen Demokratie und Gründern der Weimarer Republik – von den liberalbürgerlichen Parteien bis zur Sozialdemokratie – gelungen war, die Situation zu beruhigen und zum andern auch mangels einer schlagkräftigen revolutionären Partei. Neben ihrem Grundverständnis als Partei der proletarischen Revolution hatte die KPD in den Jahren von 1919 bis 1933 grundsätzlich drei Fragestellungen zu lösen:
1. Ihr Verhältnis zu Sowjetrussland bzw. zur Sowjetunion (unter dem Aspekt des Grades ihrer Abhängigkeit von dieser)
2. Ihre innere Parteistruktur („Sekte oder Massenpartei“ und das Maß innerparteilicher Demokratie)
3. Ihre politische Linie (Rolle innerhalb der Arbeiterbewegung und im politischen System der Weimarer Republik) inkl. des Verhältnisses zur SPD und zu den Gewerkschaften
Im Parteiensystem der Weimarer Republik war die KPD unter allen Parteien mit einer gewissen Massenbasis und ihrem darauf basierenden politischen Einfluss auf die gesellschaftlichen Prozesse eine letztlich linksradikale Partei – das heißt, die von allen agierenden Massenparteien politisch am weitesten links stehende mit dem erklärten Ziel der radikalen Umgestaltung der Weimarer Republik. Dabei war sie vom Zeitpunkt ihrer Gründung an nie ein einheitliches Gebilde. Sie konstituierte sich von Anfang an aus einer Reihe radikal linker Strömungen und Gruppierungen, deren Heterogenität und programmatische Widersprüchlichkeit den Zustand der Partei nicht nur in den ersten fünf Jahren maßgeblich beeinflussten, sondern auch darüber hinaus.
Die Mitglieder der KPD waren von dem Kommen der Revolution überzeugt, doch gab es von Beginn an keine einheitliche Auffassung zu den einzuschlagenden Wegen, auf denen man wieder in die revolutionäre Offensive kommen konnte. Das führte in den folgenden Jahren fortgesetzt zu Spaltungen und Ausschlüssen, entlang derer sich eine letztlich negative Entwicklung zu einer stalinhörigen Apparatspartei darstellen ließe.
Wichtigste Zäsuren waren:
– Die Gründung der KPD selbst an der Jahreswende 1918/1919. Bereits im ersten Quartal 1919 verlor die eben gegründete KPD mit der Ermordung Rosa Luxemburgs, Karl Liebknechts und Leo Jogiches sowie dem Tod Franz Mehrings vier ihrer wichtigsten Theoretiker, Agitatoren und Organisatoren.
– Die Trennung vom rätedemokratischen (Otto Rühle und Franz Pfempfert) und linksradikal-revolutionistischen Flügel (Hamburger Linksradikale um Fritz Wolffheim und Heinrich Laufenberg) im Oktober 1919 und die Gründung der
Kommunistischen Arbeiterpartei im April 1920
– Die Vereinigung mit dem linken Flügel der USPD zur VKPD im Dezember 1920
– Der Ausschluss des „rechtskommunistischen Flügels“ um Paul Levi im April 1921
– Die Entmachtung der „rechten“ Führung um Heinrich Brandler und August Thalheimer und die Durchsetzung des „linksradikalen“ Flügels um Ruth Fischer und Arkadij Maslow nach dem „Deutsche Oktober“ 1923 bis Mai bzw. Juli 1924
– Die Entmachtung der Fischer-Maslow-Führung und die Durchsetzung des „Thälmannschen ZK“ im September 1925
Die Auseinandersetzungen um die „Wittorf-Affäre“ 1928, die Trennung vom „rechten Flügel“ und die Gründung der KPD-Opposition zum Jahreswechsel 1928/1929
– Die Auseinandersetzungen mit der inneren Opposition um Heinz Neumann und Hermann Remmele 1931/1932
Die internen Auseinandersetzungen führten zwar ab 1924 nicht mehr zu den gravierenden Mitgliederbewegungen der Anfangsjahre, aber zu massiven Änderungen im Funktionärsapparat mit gravierenden Auswirkungen auf ihre Politikfähigkeit.
Berücksichtigt man nicht, dass es permanent Auseinandersetzungen über die einzuschlagende Taktik gab, sind die teils jähen Wendungen in der Politik und/oder Wechsel in ihrem Führungskorps nicht zu verstehen. In kaum einer Zeit und in kaum einer entscheidenden Frage ihrer Taktik bezog die KPD im Laufe ihrer Geschichte einheitlich Stellung; politische Positionen der Partei lassen sich daher nur im Hinblick auf die konkreten Bedingungen und die jeweils agierenden Personen, also konkret-historisch, analysieren oder darstellen. Zu jeder Zeit beriefen sich die jeweiligen Führer der KPD auf die marxistische und damit im Selbstverständnis wissenschaftliche Fundierung ihrer Politik – was letztlich hieß: wir haben das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und damit die Kenntnis, wie die akuten, tiefgreifenden gesellschaftlichen Konflikte und Ungerechtigkeiten zu lösen sind. Dieses grundsätzliche Wissen ließ sie dabei aber immer wiederkehrend grundsätzliche Statements mit revolutionistischen Slogans ablegen auf Kosten einer genauen Analyse der konkreten Situationen.
So gab es in der KPD zu keiner Zeit einheitliche Positionen gegenüber der Sozialdemokratie. Auch zur Einheitsfront, zur Arbeiterregierung, zum Bürgerkrieg, zur nationalen Frage etc. gab es immer nur jeweilige Beschlusslagen, an die sich jedes Parteimitglied zu halten hatte, solange sie galten. Sie konnten aber auch jederzeit als Ergebnis von zum Teil heftigen Diskussionen per Mehrheitsbeschluss verändert werden und wurden es auch. Insoweit herrschte in der KPD, zumindest bis zu ihrer 1924/25 beginnenden umfassenden „Bolschewisierung“, durchaus innerparteiliche Demokratie.
Doch gab es Differenzen nicht nur innerhalb der Parteiführung. Auch an der Basis, die eben keine bewusstlose, einfach zu dirigierende Masse war, gab es unterschiedliche Auffassungen zu den taktischen Fragen. Ob ein Kommunist beispielsweise die Einheitsfront befürwortete oder ablehnte, hing neben den „parteioffiziellen“ taktischen Richtlinien vor allem von den jeweiligen persönlichen Erfahrungen des Einzelnen oder der Parteigruppe mit den potenziellen Bündnispartnern „vor Ort“ ab.
Basierend auf Heraklits Dialektik des „Panta Rhei“ („alles fließt“): „Du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Du bist es und du bist es nicht“ kann man sagen: Die KPD von 1919 war nicht dieselbe Partei wie die von 1923 oder von 1929.
Wie eng das revolutionäre Selbstverständnis der Kommunisten an ihr Verständnis von der kapitalistischen Endkrise gebunden war, zeigt folgende Aussage August Thalheimers Ende 1921, getroffen in Auseinandersetzung mit dem Programm der Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Paul Levis: „Es liegt auf der Hand, dass, wenn ich anerkenne, dass der Kapitalismus im Begriff ist, sich aus eigener Kraft ökonomisch wiederherzustellen, (…) für die kommunistische Politik, und also für kommunistische Grundsätze und am Ende auch für die kommunistische Partei kein Boden mehr da ist. Wenn der Kapitalismus aus dieser seiner ungeheuren Krisis zu ‚normaler‘ Funktion zurückkehrt, so folgt daraus politisch, die Rückkehr zur ‚normalen‘ sozialdemokratischen Politik und Partei, die ihre verschiedenen Färbungen und Flügel haben mag, in der aber keine grundsätzlich verschiedenen programmatischen und taktischen Einstellungen möglich sind.“3
Thalheimers Aussage zeigt, dass in der KPD von Beginn an latent eine Identitätsproblematik vorhanden war: Eine Partei, die ihre Identität aus der Sicht auf eine ausweglose Krise des Kapitals und eine auf der Tagesordnung stehende Revolution gründet, musste sich selbst in Frage stellen, wenn der Kapitalismus zeigt, dass er über eine erheblich größere Anpassungsfähigkeit verfügt, als angenommen und damit eine akut revolutionäre Situation nicht mehr gegeben ist. Die KPD musste zwangsläufig in eine Identitätskrise geraten, wenn sich zeigte, dass der Kapitalismus zur Restabilisierung fähig war. Ihrer Politik wäre die Grundlage entzogen und sie müsste zum bloßen Kampf um Tagesforderungen der Lohnabhängigen zurückkehren, also sich die Verbesserung der Lebenssituation unter den bestehenden Bedingungen kümmern – entweder in Kooperation mit der Sozialdemokratie (als radikaleres
Korrektiv) oder ggfs. auch als wieder verschmelzende, einheitliche Arbeiterpartei.
Diese Konsequenz aber lag außerhalb des Vorstellungsvermögens des zu diesem Zeitpunkt führenden Theoretikers der KPD. Schlussendlich kann man (aus heutiger Sicht) fragen: Was ist die Aufgabe einer revolutionären Partei in einer nichtrevolutionären Zeit? Selbstverständlich sah keiner der damaligen Akteure in der KPD diese Fragestellung – diese waren sicher: die Bedingungen zur proletarischen Revolution waren grundsätzlich gegeben, die „Stabilisierung des Kapitalismus“ war nur eine relative, eine scheinbare, und es galt gerüstet zu sein, wenn die revolutionäre Situation von der objektiven wieder zur akuten würde. Es galt den ebenfalls für die Revolution notwendigen „subjektiven Faktor“ zu stärken.
Und hier liegt das Spannungsverhältnis zwischen Offensivtheorie und Einheitsfronttaktik in all ihren jeweiligen Schattierungen: Wie konnte dieser subjektive Faktor aktiv erhöht werden? Und konnte über diesen, über die Radikalisierung der Massen, auch Einfluss auf eine „Revolutionierung“ der objektive Bedingungen genommen werden?
Die Kommunisten standen vor der Aufgabe, den subjektiven Faktor - also die KP selbst und deren Einfluss auf die Massen – so zu entwickeln, dass sie bei Vorliegen der objektiven Bedingungen einer revolutionären Situation in der Lage war, die Revolution durchzuführen. Taktisch fanden diese Bemühungen bis zum „Deutschen Oktober 1923“ ihren Niederschlag in den Auseinandersetzungen um die Einheitsfronttaktik.
Der III. und der IV. Kongress der Kommunistischen Internationale hatten die Einheitsfront als grundsätzliche Taktik für die Zeit bestimmt, in der die Kommunisten (noch) nicht die führende Rolle in der Arbeiterbewegung innehatten: Mit der Betonung der gemeinsamen Interessen aller Arbeiter in der Tagespolitik sollten die politischen Differenzen mit den Sozialdemokraten hintangestellt werden. Angestrebt war dabei jedoch nicht ein gleichberechtigtes Miteinander, sondern bei der Umsetzung gemeinsamer Aktionen sollten die sozialdemokratischen Führer diskreditiert und entlarvt werden, da sie doch niemals mit letzter Konsequenz – das hieß bis zur Revolution – für die Interessen der Arbeiterschaft eintreten würden. Sammlung um die Fahne des Kommunismus war die Losung, d. h. Die sozialdemokratischen Arbeiter sollten im Verlauf gemeinsamer Aktionen so beeinflusst werden, dass sie sich von ihren Führern trennten und schließlich zur kommunistischen Partei übertraten. Trotz des erheblichen Aderlasses an Mitgliedern und Funktionären in unmittelbarer Folge der mitteldeutschen Märzaktion 1921 gelang es der KPD mit Hilfe der Einheitsfronttaktik, sich bis Anfang 1923 wieder zu konsolidieren und zunehmend an Einfluss in der deutschen Arbeiterbewegung zu gewinnen.
Doch die Einheitsfronttaktik war sowohl in der Kommunistischen Internationale als auch in der KPD zu keiner Zeit unumstritten und es gab von Beginn an sowohl intensiven als auch latenten internen Widerstand gegen die Einheitsfrontaktik. Der latente Widerstand (bzw. Vorbehalt) zeigte sich in der Unterscheidung zwischen „Einheitsfront von oben“ und „Einheitsfront von unten“ – Belege hierfür lassen sich in den diesbezüglich lavierenden und unkonkreten Aussagen des EKKI-Vorsitzenden Grigorij Sinowjew finden.
Nach dem Scheitern der mitteldeutschen Märzaktion 1921 und dem relativ ruhigen Jahr 1922 glaubten die Führer der KPD, der Russischen Kommunistischen Partei (Bolschewiki) [RKP(B)] und der Kommunistischen Internationale im Sommer 1923, nun endlich zum entscheidenden Schlag ausholen zu können. Ausgelöst durch die strengen Auflagen des Versailler Vertrages und beschleunigt durch die französisch-belgische Ruhrbesetzung ab 11. Januar 1923 wirkte sich in Deutschland eine tiefe sozioökonomische Krise mit Hyperinflation, Pauperisierung breiter Bevölkerungsschichten und Bankrott der Staatsfinanzen aus. Zudem war es der KPD mittels ihrer seit Ende 1921 verfolgten Einheitsfronttaktik gegenüber der SPD gelungen, eine beachtliche Massenbasis in der Arbeiterschaft zu erlangen, die sie in die Lage versetzte, im Frühjahr 1923 erstmals in einzelnen Streikaktionen die politische Führung zu übernehmen. Den russischen Oktoberaufstand von 1917 zum Vorbild nehmend und unter starker Einflussnahme des ZK der RKP(B) und des EKKI begann die KPD-Führung im August 1923 mit konkreten Planungen für einen bewaffneten Aufstand.
Meine grundsätzliche Einschätzung zum „Deutschen Oktober“: Es gab eigentlich keine Aktion, die den Namen „Deutscher Oktober“ auch nur annähernd verdient hätte. Der „deutsche Oktober“ war ein Wunschtraum, der bald zu einem Mythos wurde. Was ihn zum – wenn auch nicht stattgefundenen – Ereignis macht, sind die Vorbereitungen und die in ihn gesetzten Hoffnungen eines Teils der deutschen und internationalen Arbeiterschaft, insbesondere aber die Nachhaltigkeit seiner Nachbereitung, deren Ergebnis die „Oktoberlegende“ war.
Ich bin überzeugt, dass im Jahre 1923 in Deutschland zu keiner Zeit die Bedingungen für eine erfolgreiche proletarische Revolution gegeben waren – weder die objektiven, noch die subjektiven. Es gab 1923 in Deutschland keine Chance, die unvollendete Novemberrevolution von 1918 wieder aufzunehmen und zum Sieg zu führen. Im Sommer 1923, als die KPD möglicherweise die Mehrheit der deutschen Arbeiterschaft hinter sich hatte und sie die teils machtvollen Streiks vielleicht zu entscheidenden Kämpfen hätte ausweiten können, gab es noch keinerlei konkrete Aufstandsplanungen und -vorbereitungen. Im Herbst, als mit den Vorbereitungen zumindest begonnen worden war, war die Arbeiterschaft nicht mehr zu Kampfhandlungen bereit. Womöglich hätte die soziale Unruhe, von einer Einheitsfrontführung klug ausgenutzt, zu einer Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse in der Weimarer Republik führen können – zur Stärkung der Arbeiterorganisationen und ihrer parlamentarischen Vertretungen und zu radikalen Sozialreformen. Und vielleicht hätte schon das genügt, die zehn Jahre später – 1933 – erfolgende faschistische Machteroberung (eigentlich Machtübertragung an die NSDAP) und damit auch den 2. Weltkrieg und den Holocaust zu verhindern. Doch die einseitige Fixierung der Einheitsfront auf die Aufstandsvorbereitung durch die Kommunisten und die Gegenmaßnahmen der Stresemann-Regierung, nicht nur die rigiden, militärischen, sondern vor allem die sozioökonomischen, wie die Beendigung des „passiven Widerstands“ im August 1923 und der Hyperinflation mit der Einführung der Rentenmark Mitte November 1923, glätteten die Wogen und verhinderten im Jahre 1923 eine solche Entwicklung, indem sie die Hoffnungen auf eine rasche Besserung der sozialen Lage für einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung nährten und zu erfüllen schienen.
Doch die Führungen der KPD nach dem „Deutschen Oktober“ vermochten keine positiven Schlussfolgerungen aus den durchaus vorhandenen erfolgreichen Ergebnissen der Einheitsfronttaktik zu ziehen. Der „Deutsche Oktober“ war eine vertane Chance, eine Niederlage der auf der Tagesordnung stehenden Revolution. Statt die objektiven Gründe zu analysieren, wurden die Gefahren der „Rechtsabweichler“ stigmatisiert und diesen – personifiziert in Heinrich Brandler – vorgeworfen, die Revolution im Oktober 1923 aus Feigheit oder Opportunismus verhindert zu haben. Ernst Thälmann leitete kurz nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der KPD einen Paradigmenwechsel in der Sicht auf den „Deutschen Oktober“ ein, indem er in der Roten Fahne den Hamburger Aufstand zum bedeutendsten Ereignis des „deutschen Oktobers“ 1923 uminterpretierte: „Die Sachsenpolitik endete mit dem kampflosen Rückzug. Die Reichsexekutive, der Einmarsch der weißen Generäle, besiegelte die Niederlage. Ist damit die Geschichte des Oktobers 1923 erschöpft? Nein und abermals nein! Man beging noch später mehrfach den Fehler, in Resolutionen und Artikeln, ja sogar in Reden vor dem bürgerlichen Gericht nur auf Sachsen hinzuweisen, wenn man vom Oktober 1923 sprach. Aber es gab nicht nur Sachsen, sondern es gab auch Hamburg!“4 Bis dahin hatten die Führer der KPD und der Kommunistischen Internationale versucht zu klären, ob die in Mitteldeutschland angewendete Einheitsfrontpolitik eine grundsätzlich anzuwendende Strategie der Kommunisten war und wenn ja, welche Fehler bei ihrer Umsetzung begangen worden seien. Für Thälmann hingegen war nunmehr die Einheitsfront der „Sachsenpolitik“ nur noch Symbol der Niederlage ohne weiterzuverfolgende Ansätze. Der Hamburger Aufstand hingegen symbolisierte für ihn die allein Erfolg versprechende Taktik der Machteroberung durch die Kommunisten.
Harald Jentsch
1 - Lenin, W. I.: Der Zusammenbruch der II. Internationale, in: LW, Berlin 1961 ff., Bd. 21, S. 206 f.
2 – s. Lenin, W. I.: Was tun? Brennenden Fragen unserer Bewegung, in: LW, Berlin 1961 ff., Bd. 5, S. 355-551.
3 – August Thalheimer, Die Theorie und Praxis des Liquidatorentums. Zur Reichskonferenz der Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft (20. November), in: Die Internationale.
Zeitschrift für Praxis und Theorie des Marxismus, Berlin, 4. Jg., Nr. 1/2 (1922), S. 19.
4 – Ernst Thälmann: Die Lehren des Hamburger Aufstandes, in: Die Rote Fahne v. 23.10.1925.