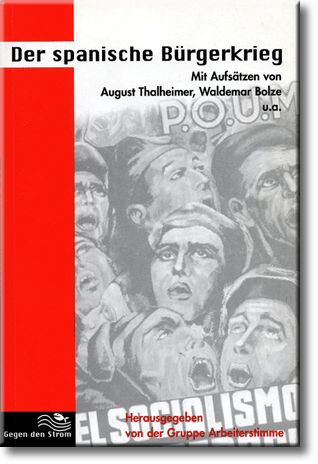Es ist Anfang Juni und endlich gibt die bayerische Landesregierung Erleichterungen in unserem Corona-Isolations-Dasein bekannt. Bisher hieß es: keine Besuche, kein Treffen und immer zu Menschen Abstand halten. Die März-Hefte der Arbeiterstimme habe ich immer noch nicht austragen können und es wird Zeit, dass politische Diskussionen wieder möglich werden. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten konnte ich an der 1. Mai-Demonstration nicht teilnehmen, der DGB hatte sie bundesweit abgesagt. Dass sich selbständig unter den Kolleginnen und Kollegen nicht mehr getan hat, ist ein schlechtes Zeichen. Wo bleibt die Bewegung, der Sport, vom Arzt empfohlen? Im Alter blieb mir bisher nur das Hallenbad, wo ich mühsam noch 20 Bahnen schaffte. Doch der „Weisheit“ Söders nach dürfen nun zwar die Freibäder wieder öffnen, aber die Hallenbäder nicht. Schade! Auch wenn die Tochter im Haushalt hilft, da ihre auswärtigen Aufträge weggebrochen sind, muss ich manchmal zum Einkaufen fahren, mit Mundschutz natürlich. Was müssen wohl andere alte Leute unter dem Zepter des Corona-Alarms alles mitmachen? Ich musste im Mai auf dem Weg zu einer Behandlung an einem Altersheim vorbei, da saß eine Frau auf einem Stuhl vor einem geschlossenen Fenster. Hinter dem Fenster kauerte eine alte Frau, um mit ihrer Tochter zu reden, „zusammen“ zu sein. Das ging mir durch Mark und Bein, nachdem ich auch noch hörte, dass dies den Vorordnungen nach nur einmal in der Woche gestattet war. Was muss ähnliches wohl für die 600.000 dementen Menschen in Deutschland bedeutet haben!
Da meine Frau krank ist und ich schon über 90 und vorgeschädigt bin, gehören wir bei den Corona-Bedrohten zu den lebensbedrohlich Gefährdeten. Wir selbst sehen das ein und verhalten uns entsprechend dem Abstandsgebot und tragen außer Haus, beim Friseur und in den Läden unsere Gesichtsmasken. Mögen auch manche Anordnungen der Regierungen überzogen erscheinen, so muss ich doch immer bedenken, dass man bei zwei Herzinfarkten kein Risiko eingehen darf. Die älteren Leute, die ringsum wohnen und noch etwas jünger wie wir sind, verhalten sich diesbezüglich noch penibler. Die psychische Belastung durch die Isolation ist bei mir nicht so stark wie bei den Jüngeren, was mehrere Gründe hat. Zum einen bin ich zu beschäftigt. Ich muss unseren Alltag bewältigen und jeden zweiten Tag ca. zwei Stunden den Garten gießen und auch darin arbeiten. Mehrere Stunden brauche ich schon zum Lesen der Tageszeitung, für andere politische Zeitschriften und Papiere, für schriftliche Arbeiten. So reicht die Zeit eigentlich nie, ob mit oder ohne Virusalarm.
Gut, dass unser Haus nahe am Walde steht, denn weit kann ich nicht mehr laufen, weil sonst der Rücken und die Beine schmerzen. Das schlecht Hören und das nachlassende Gedächtnis machen mir sowieso zu schaffen.
Ich habe in unserem ruhigem Viertel den Vorteil, in der Natur sein zu können. Ich habe aus meinem Garten mit etwa 50 alten Bäumen einen kleinen Park gemacht. Da kann die Lektüre dann auch auf der Terrasse stattfinden. Es ist in einer solchen Pandemie-Situation auch wichtig, dass man Freunde an der Seite hat, auch um Besprechungen und Diskussionen fortführen zu können. Das ist ja in diesen Umbruchzeiten wichtig geworden, wo Teile der Grundrechte außer Kraft gesetzt worden sind, ohne es vorher im Parlament abzuklären. Natürlich belastet einen die einsetzende Wirtschafts-, Sozial- und Finanzkrise, die durch die Pandemie noch verstärkt wird und die heute schon Millionen ihrer sozialen Existenz beraubt hat. Die Ungewissheit überlagert alles. Niemand weiß genau, wie der weitere Verlauf der Seuche sein wird, wie stark die Einschränkungen uns noch belasten werden, wie schlimm die Armut sich ausbreiten wird, wie viele Firmen in den Bankrott gehen. Im April noch haben die Söder und Merkel die Unterstützungsgelder wie Eurogötter angepriesen, doch jetzt geht der Streit erst richtig los, wer die Rechnung bezahlen soll. Persönlich brauche ich wohl außer Verteuerungen sozial nichts befürchten. An Bestandsrenten werden sie sich vorerst nicht ran trauen. Es ist bereits abzusehen, wie die Belange der Ökologie in den Hintergrund treten.
Heute kommt die Schreckensmeldung aus den USA: eine Million Viruskranke, 100.000 Tote und 40 Millionen Arbeitslose. Und erst in Brasilien!
Die Hauptfrage ist ja für uns, wie werden die Herrschenden den doppelten Dammbruch ausnutzen: Krankheitslawine, wirtschaftlicher Niedergang mit Schuldenpolitik auf der einen Seite, soziale Deklassierung, Verelendung, politische „Notstandsregime“ und Machtzuwachs der Exekutive auf der anderen Seite.
Wird der Widerstand in der Gesellschaft groß genug sein, diese Veränderung der Kräfteverhältnisse aufzuhalten?
Viele Menschen in Deutschland erleben die verordneten Einschränkungen zum ersten Mal in ihrem Leben mit einer von oben kommenden Fremdbestimmung und sind trotz grundsätzlicher Übereinstimmung verunsichert. Für den älteren Teil der Bevölkerung, der wie ich mit 91 schon mehrere zivilisatorische und kulturelle „Welten“ erlebt hat und überleben musste, ist die Situation nicht mehr ganz so neu und erdrückend wie für die nachkommenden Generationen; auch wohl, weil die zeitliche Begrenzung der Belastung diesmal absehbar sein könnte.
Für die meisten ist die Lage trotzdem weniger brisant als bei Katastrophen in früheren noch ärmlicheren Zeiten.
Ich wurde 1929, zehn Jahre nach dem Sturz der Monarchie, in einem eisigen Frühjahr in Nürnberg geboren und bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Als Kleinkind konnte ich natürlich nichts mitbekommen von der Bedeutung der fünf Monate später einsetzenden kapitalistischen Weltwirtschaftskrise, einer der wesentlichen Ursachen für die Machtübertragung an den Faschismus und dem von ihm angezettelten II. Weltkrieg. Es war im Leben der geschichtliche Verlauf, der mich in etwa vier Phasen jeweils zwang, damit fertig zu werden, obwohl die Familie zeitweise auseinandergerissen war. Da waren Schicksalsschläge, die manchmal schlimmer waren als die gegenwärtige Pandemie-Gefährdung und die Quarantäne-Vorschriften im Jahr 2020.
Da musste z.B. die Familie in der angeschlagenen Weimarer Republik mit der Massenarbeitslosigkeit und der sozialen Verarmung zurechtkommen. 1933 folgten zwölf Jahre Nazi-Herrschaft mit Diktatur und sechs Jahre Krieg und Zerstörung. Auf die Niederlage des „Tausendjährigen Reiches“ folgte die Militärdiktatur der USA-Besatzungsarmee mit schweren Not- und Hungerjahren, bis 1949 die D-Mark kam und die BRD gegründet werden konnte.
Es kann sein, dass in der Geschichte Deutschlands keine Generation solche gewaltigen und raschen Umbrüche erlebt hat wie die meine. Die Veränderungen waren umfassend in Zivilisation, Kultur, Technik und Politik. Darunter habe ich auch sprunghafte Fortentwicklungen erlebt: von der Petroleumlampe zum elektrischen Licht, von der Pferdekutsche zum Auto, von der preußischen Marschmusik zum Jazz, vom massenhaften Tuberkulosetod – meine halbe Verwandtschaft starb daran – zur Herzoperation, vom unumschränkten Patriarchat zu den heutigen Kinder- und Frauenrechten, von der Handarbeit zur Industrie-Automatisierung.
So waren meine Lebensabschnitte unterschiedlich gefährlich zu bewältigen: in der Kindheit mit vielen Krankheiten, in der Jugend war ich in Gefahr, an Gelbsucht zu sterben, im Krieg kamen die Bombenangriffe bis in die nächste Nachbarschaft und der Luftschutzkeller bebte; mit 14 zum „Schnellkommando“ einberufen, Schläuche legen vor brennenden Häusern und andere Einsätze. Die Schulergebnisse sahen entsprechend aus. Der Vater und der vier Jahre ältere Bruder waren im Krieg, da war ich mit meiner mich sehr umsorgenden Mutter allein. Das hieß auch bis Ende 1948 mit dem Alltag fertig zu werden: das hieß Organisieren, Tauschen, Hamstern, eine Kaninchenzucht aufziehen, mitten in der Trümmerstadt. Das nahm die ganze Kraft in Anspruch.
Es gab auch riskante Situationen, die lebensgefährlich hätten werden können: Stabbrandbomben durchschlugen das Dach, die Blindgänger warf ich auf den Hof. Neben unserm Haus ging eine Bombe auf eine Bäckerei nieder und zerstörte das Nachbarhaus. 30 Meter weiter riss eine Granate das Hauseck weg. Kurz vor der Einnahme Nürnbergs erhielt ich den Gestellungsbefehl zum Volkssturm, das war drei Wochen, bevor ich sechzehn wurde. Nach der Vereidigung in Rummelsberg desertierte ich mit einem Schulkameraden über die Bahngleise nach Nürnberg. Wir wollten uns nicht mehr verheizen lassen. Hätte die SS uns erwischt, wären wir aufgeknüpft worden.
In den Nachkriegsjahren wäre dann fast die ganze Familie verhungert, da wir, wie etwa die Hälfte der Bevölkerung, keine Beziehungen zu Bauern und Produzenten hatten.
Politisch bin ich erst in den letzten Kriegsjahren „aufgewacht“, als die Kriegsereignisse das Misstrauen verstärkten und das Abhören der „Feindsender“ (Radio Beromünster, Soldatensender Kiew) Lügen der Nazipropaganda entlarvten. Die erste Phase der Besatzung durch die GIs war auch brisant, sie nahmen unsere Wohnung als Stützpunkt. Wir hausten dann im Keller, mitsamt den Großeltern, die im Januar ausgebombt worden waren.
Das Wichtigste für uns war, dass im Krieg niemand aus der Familie umgekommen war. Alles andere an Schrecken, Verlusten und Entbehrungen hatten wir, auch mit viel Glück, überstanden.
Aus den Erfahrungen dieser 19 Jahre entstand langsam die Erkenntnis der Wichtigkeit von Politik; aber ohne dass es zur Begegnung mit Menschen gekommen wäre, die sich für Humanismus und Sozialismus einsetzten, hätte ich mich wohl kaum nach links engagiert. Es war ein zäher Prozess, bis ich zum Marxismus fand, verbunden mit einem langen Selbststudium. Angefangen hatte es nach dem Krieg mit der „Ohne mich-Bewegung“ der Organisierung 1951 bei den Kriegsdienstverweigerern, der Teilnahme an der Antiremilitarisierungsbewegung und der Mitwirkung bei Gustav Heinemanns GVP. Nach deren Scheitern fand ich schließlich zur Arbeiterbewegung und damit 1956 zur Annäherung an die „Gruppe Arbeiterpolitik“.
Nun im Alter spüre ich die Notwendigkeit, soweit die Kräfte reichen, weiter an den sozialistischen Zielen mitzuarbeiten und meine politischen Erkenntnisse weiterzugeben.
H.S