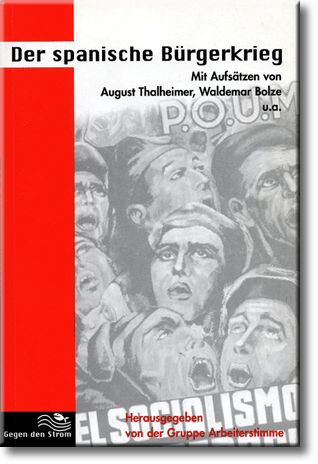Die Probleme in der Ampelkoalition waren seit langem unübersehbar. Ständig und ausführlich wurde in den Medien über die internen Differenzen und Streitereien berichtet. Von Umfrage zu Umfrage schmolz die Zufriedenheit der Wähler mit der Koalition. Wie inzwischen bekannt wurde, haben alle an der Ampel beteiligten Parteien im Vorfeld intern über ein mögliches Ende der Koalition nachgedacht, ohne aber gleich in dieser Richtung aktiv zu werden. Der Grund für das Zögern ist ein einfacher. Aus Sicht der drei Koalitionsparteien fehlte es schlicht und einfach an attraktiven oder zumindest akzeptablen Alternativen, um dafür das Risiko des Koalitionsbruchs einzugehen.
Nach den für sie katastrophalen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg kam die FDP anscheinend zu einer neuen Beurteilung der Lage. Ein „Weiter so“ in der Regierung bringe für sie nichts mehr und würde ihre Aussichten bei der spätestens im Herbst 2025 fälligen Bundestagswahl nur noch weiter verschlechtern, so die neue Einschätzung. Deshalb begann die FDP gezielt auf das Koalitionsende hinzuarbeiten. Dabei wollte sie sich nochmals als entschlossene Hüterin von Haushaltsdisziplin und Schuldenbremse in Szene setzen, um damit bei ihrem potenziellen Anhang zu punkten.
Bei den Finanzen ging in der Koalition nichts mehr
Bei Koalitionsbeginn glaubten die drei Parteien noch, ihre jeweiligen Anliegen in die Regierungsarbeit einbringen und erfolgreich umsetzen zu können. Die Kurzfassung des Regierungsprogramms lautete „Modernisierung der Gesellschaft“. Auf diese Formel konnten sich alle verständigen, auch wenn sie nicht immer exakt das Gleiche darunter verstanden. Die Modernisierung schließt vieles ein, z.B. die Klimatransformation, Wirtschaftsförderung, Investitionen in verschiedene Bereiche der Infrastruktur (z.B. Bahn, Digitalisierung), aber auch ein Selbstbestimmungsgesetz oder sozialpolitische Anliegen (Mindestlohn, Bürgergeld, Rentenpaket). Für die FDP war dabei die generelle Beachtung der neoliberalen Prinzipien selbstverständlich. Von SPD und Grünen kam dazu kein Widerspruch. Aus der Sicht von Ende 2021 war das aber nicht unrealistisch. Die Lage der Staatsfinanzen schien damals einen gewissen Spielraum für die Anliegen von SPD und Grünen zu ermöglichen. Deshalb konnte im Koalitionsvertrag die Einhaltung der Schuldenbremse und zugleich ein Verzicht auf Steuererhöhungen versprochen werden.
Dann kamen der Ukraine-Krieg, der Anstieg der Energiepreise, ein kräftiger Inflationsschub, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltsführung und, etwas neueren Datums, die anhaltende Stagnation in der Wirtschaft, die sich immer deutlicher abzeichnende Krise in der Autoindustrie und, ganz aktuell nach der Wahl von Donald Trump, die zu erwartenden Folgen von dessen Politik.
Diese hier nur kurz aufgezählten Punkte1 veränderten die Lage deutlich. Und fast immer erforderte die neue Lage zusätzliche staatliche Ausgaben. Der vorhandene finanzielle Spielraum war schnell ausgeschöpft, aber die Aufgaben und Probleme waren damit bei weitem noch nicht abgearbeitet. Für die Zukunft zeichnete sich keinerlei Entspannung der Haushaltslage ab, sondern, im Gegenteil, weitere Verschärfungen. Deshalb rückten Finanzierungsfragen in den Mittelpunkt der koalitionsinternen Auseinandersetzungen. Trotz der geänderten Rahmenbedingungen beharrte die FDP auf ihren Vorstellungen. Ein Aussetzen der Schuldenbremse durch die Feststellung einer Notlage (etwa bedingt durch den Ukraine-Krieg) lehnte sie ab und selbstverständlich auch Steuererhöhungen oder dergleichen.
Nur beim sogenannten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr konnte gemeinsam mit der CDU/CSU-Opposition über eine Verfassungsänderung eine gesonderte Finanzierung gefunden werden. Aber danach ging nichts mehr. Es ist bemerkenswert, dass sich die Parteien nicht über den Sinn oder Unsinn von Ausgaben zerstritten haben, hier bestand oft breiter Konsens, sondern „nur“ über deren Finanzierung. Die massive Erhöhung der Rüstungsausgaben ist dafür ein gutes Beispiel. Die eigentlich entscheidende Frage – Aufrüstung, ja oder nein - war nicht das Problem dieser Koalition. Alle Ampelparteien erklärten, eine deutliche und dauerhafte Steigerung bei den Militärausgaben sei wegen der Bedrohung durch Russland unabweisbar, alle sprachen sich für das 2%-Ziel der NATO aus. Aber die Regierung hatte das Problem, diese ihre erklärte politische Absicht konkret umzusetzen. Das fing beim geplanten, jetzt nicht mehr verabschiedeten Haushalt für 2025 an und zeigte sich ganz deutlich in der mittelfristigen Finanzplanung für die nächsten Jahre.
Auch bei anderen Aufgaben wiederholte sich dieses Spiel. Egal, ob es um verbilligten Industriestrom, sonstige Subventionen, Steuererleichterungen für Unternehmer und dergleichen ging. Über alle diese Maßnahmen hätte sich die Koalition einigen können, nur nicht über deren Finanzierung. Für die FDP waren Mehrausgaben nur denkbar, wenn an anderen Stellen entsprechend eingespart würde. Prädestiniert für Einsparungen ist aus Sicht der FDP, wie eh und je, der Sozialbereich. Jede andere Finanzierungsmöglichkeit versperrte sie.
Der Kampf um's Geld kommt noch
Mit dem Ende der Ampel und die vorgezogenen Wahlen am 23. Februar sind diese Probleme aber nicht gelöst. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass Finanzierungsfragen bei den kommenden Koalitionsverhandlungen wieder von zentraler Bedeutung sein werden. Oder, anders ausgedrückt, wer oder was hauptsächlich unter Kürzungen zu leiden haben wird, muss noch entschieden werden.
Wenn man die im Raume stehenden Summen betrachtet, wird klar, kleinere Einsparungen hier oder dort genügen nicht, es sind erhebliche Kürzungen bzw. Umschichtungen notwendig. Allein, was die Rüstung betrifft, werden jährliche Mittel von mindestens 80 Milliarden genannt (2024 belief sich der Verteidigungshaushalt auf 51,95 Milliarden, 2021 auf 46,93). Das 2%-Ziel der NATO wird nur noch als absolutes Minimum bezeichnet, notwendig wären eigentlich 3 % des BIP. So unisono die Argumentation von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP.
Die lahmende Wirtschaft ruft nach Subventionen, steuerlichen Entlastungen und vielerlei sonstigen Unterstützungen. Auch der Finanzbedarf für Investitionen in die Infrastruktur und für die Klimatransformation besteht offensichtlich weiterhin.
Ähnlich wie bei der Ampel stellt sich nach den Wahlen für alle denkbaren Koalitionen die Frage, wo die Finanzmittel herkommen sollen. Nicht nur die FDP, auch die CDU/CSU hat sich grundsätzlich gegen Steuererhöhungen ausgesprochen. Diese Möglichkeit für eine relevante Vergrößerung der Staatseinnahmen soll aber erklärtermaßen nicht verfolgt werden.
Einer signifikanten Erhöhung der Kreditaufnahme steht bekanntlich die Schuldenbremse, die 2009 in die Verfassung aufgenommen wurde, im Wege. Möglicherweise strebt eine künftige Regierung eine Reform der Schuldenbremse an. Die bisher gültige Variante hat sich als wenig flexibel herausgestellt und wird deshalb auf breiter Front ( z.B. auch von den sogenannten Wirtschaftsweisen) zur Diskussion gestellt. Fraglich ist allerdings, wie weit eine Reform gehen kann. Aufgrund der im konservativen/neoliberalen Lager vorhandenen grundsätzlichen Bedenken gegenüber einer Ausdehnung der Staatsschulden ist es eher unwahrscheinlich, dass sich eine Zweidrittelmehrheit findet, die zu einer großen und umfassenden Reform bereit wäre. Unter den gegebenen Bedingungen ist, wenn überhaupt, eher eine begrenzte Reform zu erwarten, die sich auf eine relativ geringfügige Flexibilisierung der Möglichkeiten staatlicher Verschuldung beschränkt.
Im Rahmen der Regierungsbildung ist mit heftigen Auseinandersetzungen um die Verteilung der Finanzen zu rechnen. Insbesondere dürften Angriffe auf das bisherige Niveau das Sozialstaates drohen und, damit verbunden, auch auf den Lebensstandard breiter Schichten. Es ist davon auszugehen, dass es in den Parteien (in CDU/CSU und FDP sowieso, aber auch bei SPD und den Grünen) einflussreiche Kreise gibt, aus deren Sicht ein generelles Zurückdrängen der Sozialausgaben notwendig ist. Oberflächlich gesehen, um den Staatshaushalt zu entlasten und um Raum für „Zukunftsinvestitionen“ zu schaffen, wie das in ihrer Propaganda genannt wird. Aber die Absichten sind noch wesentlich weiter gesteckt. Der Sozialstaat wird vor allem als eine Belastung für das Kapital gesehen. Eine Belastung, die keinesfalls über ein bestimmtes Maß hinausgehen dürfe. Und dieses akzeptable Maß sei in Deutschland bereits überschritten. Deshalb müsse der Sozialstaat notwendigerweise beschnitten werden.
Damit ist der Versuch verbunden, die Profitrate für das Kapital wieder anzuheben und die internationale Konkurrenzfähigkeit des Standorts zu steigern. Natürlich wissen die Parteien auch, dass ein solches Unterfangen unpopulär und politisch heikel ist. Sie gehen deshalb meistens vorsichtig vor und warten auf günstige Gelegenheiten.
Eine neue, vermutlich CDU-geführte Regierung dürfte daran gehen, harte Einschnitte gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit durchzusetzen. Da kann man noch vieles auf echte oder vermeintliche Fehler der alten Regierung schieben. Die schlechte Wirtschaftslage, insbesondere bei der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer, der Ukraine-Krieg und der US-Präsident Trump eignen sich gut, um eine einschüchternde Drohkulisse aufzubauen und um daraus vermeintlich logische Begründungen für das „enger Schnallen des Gürtels“ zu basteln.
Ob eine wahrscheinlich deutlich geschwächte SPD unter einem eventuellen Bundeskanzler Merz da noch sehr viel Widerstand leisten kann, ist fraglich. Fraglich ist aber auch, ob sie das letztlich überhaupt will. Sicher, die SPD wird immer einige soziale Themen als ihr Markenzeichen hochhalten und auch die CDU/CSU dürfte nicht an einem allzu brutalen Vorgehen interessiert sein. Ob damit aber ein schleichender und langfristig konzipierter Abbau des Sozialstaates verhindert wird ? Die neoliberale Logik wird jedenfalls auch innerhalb der SPD als weitgehend alternativlos angesehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Sozialdemokraten vor angeblich „notwendigen Sachzwängen“ einknicken und vieles, zwar mit großen Bedenken und nach angeblich hartem Widerstand, dann doch mittragen, „verantwortungsbewusst“ wie sie sind.
Was wählen ?
Es soll hier nicht über den Wahlausgang spekuliert werden. Jeder kennt die Umfragen. Auch die Grenzen solcher Umfragen für eine Prognose des tatsächlichen Wahlausgangs sind bekannt.
In letzter Zeit haben wir uns mehrmals mit der grundsätzlichen politischen Lage in Deutschland, mit der Situation der Arbeiterklasse und mit dem Wahlverhalten, insbesondere dem Erstarken der AfD, auseinandergesetzt2. Diese Analysen sind weiterhin gültig. Seitdem hat sich nichts Wesentliches verändert.
Neu ist, dass diesmal bei Bundestagswahlen zwei Parteien zur Wahl stehen, die einerseits für Linke prinzipiell wählbar sind und die gleichzeitig auch eine, zumindest geringe, Chance haben, in das Parlament einzuziehen: die Partei „Die Linke“ (DL) und das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW).
Über beide Parteien, ihre Eigenheiten, Grenzen und Chancen ist bereits mehrfach geschrieben worden3. Das muss hier nicht wiederholt werden.
Welche Wahl die sinnvollere ist, ist nicht einfach zu entscheiden. Für die DL spricht, dass sie unter anderem ein Sammelbecken für viele Linke ist, die sich dort engagieren und ihr Wirken etwas koordinieren, was allerdings zugleich eines der Probleme der DL (Meinungsvielfalt und Zerstrittenheit) darstellt. Trotzdem, ein deutlicher Misserfolg bei den Wahlen und ein deshalb drohender Abstieg in die Bedeutungslosigkeit wäre ein echter Verlust. Selbstverständlich geht es auch darum, Einrichtungen wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung zu erhalten. Es ist zu hoffen, dass in den Wahlkreisen, in denen die Direktkandidaten der DL realistische Chancen haben, diese von allen Linken (hier im weitesten Sinne gemeint) unterstützt werden.
Das BSW scheint, rein auf die 5%-Hürde bezogen, die größeren Chancen zu haben, im neuen Bundestag vertreten zu sein. Damit wäre auch besser abgesichert, dass eine abgegebene Stimme nicht einfach unter den Tisch fällt. Bei der Friedensfrage und was die Rüstung betrifft, vertritt das BSW, im Vergleich zur auch hier nicht mit einer Stimme sprechenden DL, die klarere und bessere Position. Aber noch ist diese Partei sehr neu und noch ist nicht abzusehen, wohin genau Sahra Wagenknecht diese Partei führt. Zur Zeit muss man das so sagen: die Ausrichtung auf diese eine Person ist dominant. Ob das länger so bleiben wird oder ob die Partei allmählich ein Eigenleben entwickeln kann, und welches das dann sein wird, muss sich erst künftig zeigen.
1 Arbeiterstimme Nr. 219, S1 „Zeitenwende“ auch für die Wirtschaft? Arbeiterstimme Nr. 223, S1 Die Ampelkoalition in Schwierigkeiten
2 Arbeiterstimme Nr. 225, S1 Erfolge der AfD und komplizierte Regierungsbildungen; S4 Die Früchte der Krise: warum die AfD im Osten profitiert
3 Arbeiterstimme Nr. 222, S9 Partei Die Linke – Das Ende eines linken Projekts?; S13 Spaltprodukt BSW – Wohin geht die Reise ? Arbeiterstimme Nr. 224, S14 Brauchen wir eine linke Partei und was soll sie?